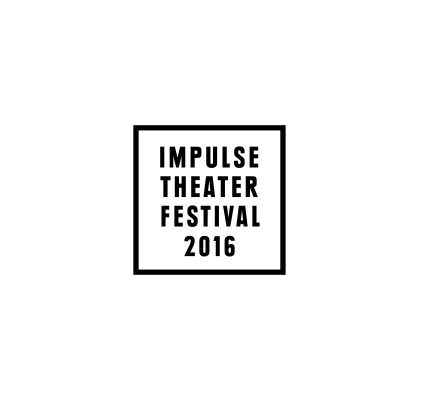Liebe mich von den Kämpfen aus
18 Mai 2015
Jörg Albrecht über die ökonomischen Kämpfe des Freien Theaters und Rocky Balboa.
Neulich, im Auge des Tigers: Ich kam in letzter Minute zum Termin mit dieser Journalistin, doch hatte meinen Terminkalender zuhause vergessen und wusste auf Teufel komm raus nicht mehr, ob das nun ein Interview zu meiner Boxkarriere war oder zu meinen Performances. Und ich dachte: Sobald sie die erste Frage stellt, werde ich es wissen. Doch die Fragen halfen mir überhaupt nicht, jede einzelne klang so, als könnte sie sich aufs Boxen beziehen UND auf Performances. Und ich begann, sehr zögerlich zu antworten. Wie ist es möglich, dass ein so netter und höflicher junger Mann wie Sie im Ring so bösartig ist?, fragte mich die Journalistin, bevor sie mir – ohne die Antwort abzuwarten – anvertraute, dass sie selber früher ein netter, höflicher und bösartiger junger Mann gewesen war. Wieso sollte ich im Ring nicht bösartig sein?, fragte ich.
Und jetzt gehe ich in den Ring.
1 Out of my leak
Es gibt keine Pause mehr. Permanent dreht sich das freie Theater- und Performancegeschäft. Permanent eröffnet irgendwo ein Festival oder ein Haus unter neuer Leitung, permanent dringen neue Formationen, Ansätze, Stimmen in die Szene, permanent feiert eine noch längere Durational Performance, ein noch interaktiveres Game oder ein noch authentischeres Dokumentarstück Premiere. Und permanent steht dieses Gebilde unter Druck. Um diesem Druck etwas entgegenhalten zu können, müssen wir schon ordentlich trainieren, right?
Und was ist jetzt dabei herausgekommen? Was für ein Körper hat sich da aufgebaut, aus dem, was vor zehn, sicher fünfzehn Jahren eben noch uneinheitlicher, unüberblickbarer und vor allem untrainierter war? Ein Haufen Muskeln. Sie erinnern mich an die Muskeln von Rocky Balboa. Allerdings entsprechen die Muskeln Balboas nur bedingt den Muskeln eines realen Boxers. Eher ist der Body von Balboa der Body eines Bodybuilders. Also, sind seine Muskeln nur Dekor? Und, überhaupt: Was heißt es, wenn man eher das Gefühl von etwas haben will als dieses Etwas selbst?
Als Ende des Jahres 2014 der Ringlokschuppen Ruhr in Not geriet, als bekannt wurde, dass ein sechsstelliges Defizit seine Existenz bedrohte, waren die solidarischen Kräfte verlässlich zur Stelle. Sie alle fürchteten, das NUR durch die wirtschaftliche Schieflage etwas verlorengehen könnte, was weitaus wertvoller war als alle monetären Summen, die in zwanzig Jahren in dieses Haus geflossen waren: dieser Ort als einer des praxeologischen Nachdenkens darüber, wie das Politische und das Performative in einer Stadtgesellschaft heute zusammenwirken. Dieser einen Furcht trat die andere entgegen, dass die Urheber des Defizits in Mülheim gleich den Ruf der freien Theaterszene oder der Künstler überhaupt in den Dreck ziehen könnten. Es war die Furcht, alles sein zu können, NUR NICHT ökonomisch genug. Wenigstens müssen wir doch buchhalterisch versiert erscheinen!
Ich kann ja Socken anziehen. Aber ich muss mich so fühlen, als hätte ich keine an, sagt Sylvester Stallone. Ohne Socken fühle ich mich mehr als Kämpfer. Dann fühle ich mich größer. Stallone war ja auch nur 1,77 Meter groß war und wurde in den Filmen dennoch Weltmeister im Schwergewicht. Obwohl es nie einen Schwergewichts-Weltmeister gab, der kleiner als 1,80 war. Ohne Socken fühle ich mich wie Schwergewicht, sagt Sylvester Stallone. Intellektuelles Schwergewicht, schiebt er nach. Und wir schauen uns Rocky in allen sechs Filmen an und denken: Aha. Ja. Schon klar. Die unerbittlichsten Gegner, im Ring und draußen, sind eben unsere eigenen Bilder.
Also was wollen wir: das Gefühl von etwas oder dieses Etwas selbst? Was ist unser Verhältnis zur Ökonomie? Haushalten können, das muss man, das ist – wenn man Verantwortung für eine Institution trägt – schwer zu bestreiten. Und dennoch bleibt die Frage: Wollen wir im Ring wirklich keine Socken tragen? Oder wollen wir uns nur so fühlen, als trügen wir keine? Wollen wir uns dem Primat der Ökonomie ausliefern? Oder wollen wir sie nur so gut kennenlernen, dass wir die Betriebswirtschaftssocken auch wieder wegwerfen können?
Und wie könnte das bei einem Haus wie dem Ringlokschuppen Ruhr aussehen? Ein Haus, das von achtzehn Mitarbeitern acht entlassen musste. Is doch gut so, sagten einige, ist doch alles flexibler. Nach Bedarf Leute dazu holen und dann wieder wegschicken, wegkicken. So wie überall. Aber in welche Richtung soll ich dann denken? Für mehr Veranstaltungen brauche ich mehr Personal, aber wenn ich das Personal für die Veranstaltung bezahle, habe ich die Veranstaltung selbst noch nicht bezahlt. Und andersrum.
Wenn du in die Offensive gehst, und dein Gegner ist einfach schneller und schlägt durch deine fehlende Deckung. Und auf einmal bist du wieder dort, wo du angefangen hast. Doch du erträgst den Schmerz und wartest auf den nächsten guten Augenblick. Es wird schmerzlich sein, bei diesen Kämpfen zuzusehen. Es ist schmerzlich, zu sehen, dass ein Ort, der für seine qualitativ hohe, faire, unendlich freundliche und hochpolitische Arbeit viel mehr Budget und Personal verdient hätte, jetzt mit noch weniger auskommen muss. Vom Sparringspartner zum Sparpartner – eine Aufstiegsstory.
2 Stagnation management
In Rocky IV sagt Rocky zu seiner Frau Adrian vor dem Kampf: Don’t leave town. So als könnte er, aus dem Ring zurückgekehrt, feststellen, dass alles anders ist als zuvor. So als wäre die Zeit im Ring eine andere. So als würde der Kampf nicht etwa zwölf Runden à drei Minuten dauern, sondern viel länger, und als wäre danach nicht nur Adrian aus der Stadt verschwunden, sondern die Stadt selbst längst entvölkert, überwuchert
und zerrieben, von Wüstensand.
So ähnlich ging es vielleicht den Stadt- und Staatstheatern, als sie in den vergangenen Jahren – von den neuen Formaten der freien Szene unter Druck gesetzt – aus den abgedichteten Proberäumen und aus den noch abgedichteteren Aufführungssälen wieder in die Wirklichkeit zurückfanden und sich fragten: Waren wir eigentlich Jahrzehnte lang weg?
Rocky Balboa hat nicht unbedingt schärfere Konturen als das deutsche Stadttheater. Er ist, zumindest wenn man sich die Filme in Originalsprache anschaut, viel weniger linear, hart und klar, als die deutsche Synchronfassung es verkaufen will. Da ist viel mehr Ambivalenz, und irgendwann verschwimmen die Umrisse eben. Werden die Konturen, wenn sie wieder schärfer werden sollten, auf einmal einen anderen Rocky zeigen?
Die Frage, wie sich das deutschsprachige Theatersystem wandeln kann, in wie vielen Runden wir es schaffen werden, eine Struktur, die von Nationalkulturen geprägt ist, darüber hinauszutragen, ist eine der aufregendsten, die es derzeit gibt. Dass sich die Lage ändern muss, ist klar – sowohl denen in der einen, als auch denen in der anderen Ringecke. Aber ist das hier überhaupt ein Kampf zweier Systeme, so wie in Rocky
IV der US-amerikanische Kapitalismus gegen den Kommunismus Moskauer Prägung kämpft, also: Rocky versus Ivan Drago, also: Sylvester Stallone versus Dolph Lundgren?
Dabei wird der sowjetische Ivan Drago als computer-unterstützter, cleaner Android inszeniert, während Rocky sich für die Vorbereitung des Kampfes archaisch gibt und in die russische Wildnis zurückzieht, um das Auge des Tigers zu finden. Wieso sieht das eine System aus, wie das andere aussehen müsste?
Nein, damit will ich nicht die These aufstellen, dass das, was wir von der freien Szene erwarten, eigentlich das Stadttheater leistet – aber auch nicht umgekehrt. Ich will auch nicht die Erfolgsideologie bekräftigten, die mal wieder zum Zuge kommt, als Rocky, der herzensgute Italo-Amerikaner, doch gegen die Maschine aus dem kommunistischen Osten gewinnt. Ich will niemandes Sieg herbeireden, weil dieser Kampf der Systeme ja keiner ist.
Ich möchte fragen: Wollen wir überhaupt die alten Champions aus dem Ring knocken? Denn wenn etwas klar geworden ist seit der Bankenkrise, der Krise eines Marktes, der aus allem mit einem Grinsen hervorgeht –: Nichts, was weg ist, wird wiederkommen. Die Angriffe, die Finten, die Haken gegen das Stadttheater seitens der freien Szene, wohin führen sie? Manchmal hören sich diese Angriffe an, als wollten die Angreifer eigentlich gar nichts ändern: Man will nur andere Inhalte, andere Protagonisten, man will alles hipper und internationaler, aber im Grunde dasselbe System. Ich warte auf den Künstler, der daraufhin das Schild hochhält: I am not content.
Wann wird das freie Theater begreifen, dass das Argument, das System sei erstarrt und müsse flexibilisiert werden – selbst wenn es stimmt! – immer auch denen in die Hände spielt, denen der Kunstbetrieb per se suspekt ist und, also am besten beseitigt werden sollte. Wo ist die Rhetorik der freien Szene mit der Rhetorik der Privatwirtschaft deckungsgleich, wenn die darüber spricht, dass die wahren Innovationen nur aus dem Nicht-Staatlichen kämen?
Der Mythos, der neue Champion komme aus der Garage, wo er, am Bocksack trainierend, zu voller Größe gewachsen sei. Dabei ist, wie unter anderem Mariana Mazzucato gezeigt hat, das klassische Garagen-Unternehmen Apple immer wieder, bis heute, auf die staatlich geförderten Techno-logien angewiesen, ohne die keines der Erfolgsprodukte, weder iPod noch iPad, denkbar gewesen wäre.
3 Commercial kindness
Es kommt nicht darauf an, wie viel du austeilst, sondern, wie viel du einstecken kannst. Das war zumindest noch so, als ich zwanzig war. Aber jetzt bin ich einundzwanzig, und die Gesetze haben sich geändert. Denn
inzwischen muss ich auch austeilen, professionelles Flair nämlich. Im Leben geht es ja einzig und allein darum, die Zeit zwischen den Auftritten hinter mich zu bringen. Um wieder zu glänzen. Und zu verdecken, wie spielend leicht ich dieses Glänzen hinbekomme. Ich habe den perfekten Plan für jede einzelne Station meines Lebens, aber die ganze Zeit tue ich so, als haderte ich unglaublich mit jeder Entscheidung, von der nur ich weiß, ich habe sie lange, lange im voraus getroffen. Und doch verkaufe ich sie als Ergebnis schwerster Unwägbarkeiten.
Manchmal kommt mir die Bewegung des freien Theaters hin zur Professionalisierung so vor. Nicht dass die Künstler*innen nicht haderten. Doch dass immer wieder – seitens der Kurator*innen, seitens des Journalismus – explizit darauf hingewiesen wird, wie schnell, stark und gut die Professionalisierung vorangehe, zeigt das Dilemma der freien Szene: einerseits sich selbst und der Politik beweisen, dass man produktiv und effektiv, eben: Profi ist, und andererseits all das noch mit Kunst verbinden.
In Ausschreibungstexten für leitende Positionen greift die Kulturpolitik wiederum auf die Sprache zurück, in der die Szene über sich selbst spricht, und fordert „größeren Austausch mit nationalen und internationalen Kurator*innen und Leiter*innen von Spielstätten und Festivals“, damit „das Festival zu einem Ort auch von Networking und professionellem Austausch“ wird [Ausschreibung Leitung FAVORITEN 2016].
Ist das schon die kuratierte Wirklichkeit? OH YES! Und statt dem schwitzenden Rocky mit Beißleiste im Mund komme ich mir vor wie die Fee bei Cinderella, die mit ihrem Zauberstab aus einem Haufen Künstlergruppen ein funktionierendes globales Netzwerk macht, aus einem Festival für ein Bundesland ein internationales fancy Ding und aus der dort gezeigten Kunst aufgemotztes Stadtmarketing.
Na, Hauptsache, es gibt n paar aussaugekräftige Fotos. Ansonsten hat der Boxkampf doch gar nicht stattgefunden. Und am besten ihr setzt euch schön nach vorne, ja, ihr alle, und zwar jetzt, dann sieht die
Veranstaltung wenigstens auf den Bildern nach Erfolg aus.
Aber wie, bitte, wie gehen wir denn mit Sichtbarkeit um? Ist denn nach aller Beschäftigung mit dem neoliberalen System nicht klar, dass man mit mehr Sichtbarkeit immer AUCH verliert? Es gibt eben keinen Gong mehr, kein DING-DING-DING, das den einen zum Gewinner erklärt und den anderen zum Verlierer. Wir sind immer beides, vor allem dann, wenn wir uns noch sichtbarer machen wollen. Natürlich ist die Bredouille, dass alles auch gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik zu legitimieren ist. Aber können wir gute und wirksame Kunst nur ermöglichen, indem wir sie in die Sichtbarkeit zerren? Und worauf hoffen wir insgeheim?
Die Erfolgsstory des Rocky Balboa versus: die Leidensstory des Rocky Balboa. Und das größte Leid ist nicht das Aushalten der Schläge im Ring, sondern der permanente Druck, sich als durch und durch erfolgreich zu
inszenieren, als möglich, also eben nicht: unmöglich. Rockys Gedanken: Ich wäre gern mehr, ohne so viel mehr tun zu müssen als andere, aber ich gehöre nicht an denselben Platz wie andere, und wenn ich ihn
möchte, muss ich ihn erkämpfen. Dann steigt er wieder in den Ring. Die Kämpfe um Artikulation, um Anerkennung. Ja, das ist der einzige Weg. Ich würde gern mehr Rendite abwerfen.
Oder können wenigstens wir die Ideologie der Rendite abwerfen? Diese Ideologie, die jede Immobilie, jeden Arbeitsplatz und jede Erzählung in Beschlag genommen hat. I am no commercial kind of guy. I am a fighter.
That’s what I do for a living! NEIN! Wir sollten das Sprechen über Zahlen nicht einfach den Zahlenmenschen überlassen, sicher nicht, auch nicht den Zahlenmenschen in uns. Aber was geschieht, wenn unsere Rhetorik
vor allem die Rhetorik des Marktes wird? Und was, wenn diese Rhetorik naturalisiert wird und damit zum Denken?
Selbst Rocky ist letztlich keine Erfolgsgeschichte, sondern zeigt eher, wie der Neoliberalismus NICHT funktioniert hat. Auch wenn der uns immer noch selbstsicher lächelnd gegenübersitzt und ins Pressekonferenz-Mic sagt: Ich will meinen Gegner nicht K.O. schlagen. Ich will ihn treffen,
beiseite gehen und zusehen, wie er leidet. Ich will sein Herz. Wenn man drei Schritte zurücktritt, die Augen zusammenpresst und die Märkte, die sich in die freien Kämpfe boxen, und die Boxer, die auf dem freien
Markt kämpfen, einmal kurz unscharf stellt, erzählen uns die Rockyfilme die Geschichte eines Optimismus, der in aller Unbarmherzigkeit gegen uns vorgeht, obwohl wir es sind, die ihn aufbringen: uns immer wieder
hochkämpfen, immer wieder abstürzen, immer wieder die Hoffnung, irgendwann wird alles gut sein. Du musst nur weitermachen. Weiter. MACHEN! Und irgendwann wirst auch du ein Times Square sein. Alles, was wir brauchen, sind: Dramatic infusions! Dramatic infusions! Dramatic infusions of capital investment!
Schreiben Sie schon mal die Verschwendungsnachweise.
4 I’m very urban
Neulich, im Place Management: Ich nahm den alten Boxer an die Seite. Er zitterte, und auf einem Auge sah er so gut wie nichts mehr. Ich führte ihn vor eine Leinwand, warf ein Dia darauf, das dieses Viertel zu einer anderen Zeit zeigte. Und er schüttelte den Kopf, senkte ihn, ich dachte, er weinte, doch er lachte und sagte: Remember you said if you stay one place long enough you become that place?
Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts können Städte gar nicht mehr nur sie selbst sein. Sie weisen – ob sie wollen oder nicht – immer schon über sich hinaus, sei es durch die Ströme der globalisierten Waren oder
dadurch, dass die einzelnen Orte, an denen diese globalisierten Waren konsumiert werden, überall gleich aussehen. Im Rahmen von City Branding wird von der Internationalisierung der Städte gesprochen, vom
Werden der Metropolen, von Kreativstädten, selbst wenn das, wie im Falle des Ruhrgebiets, ein Aufkleber bleibt, der gerade die Eigenheiten überklebt, die vorhanden sind.
Rocky Balboa kommt aus einem ärmlichen Viertel Philadelphias. Und letzten Endes kehrt er immer wieder dorthin zurück. Schon im zweiten Teil der Saga putzt er wieder die Umkleiden im Boxstudio, in dem er
groß wurde. Und im vorerst letzten Teil, dem sechsten, hat er in genau diesem Viertel ein Restaurant eröffnet. Zwischendurch bewohnt er mit seiner Frau Adrian und später ihrem Sohn auch mal eine Villa. Doch die
neue Prekarität im Neoliberalismus zeigt sich auch hier, in Rocky V, als Rockys Schwager durch unvohersagbare Geldgeschäfte Rockys Vermögen von einem Tag auf den anderen verspielt.
Das Viertel aber, aus dem Rocky kommt und in dem er wieder landet, hat sich nach dreißig Jahren nicht sichtbar weiterentwickelt, ist noch genauso heruntergekommen und ungentrifiziert wie zuvor. Und ist es
nicht auch schön, wenn Orte sich nicht weiterentwickeln, nicht sichtbar, und sich dennoch mehr und mehr verwickeln, in irgendwas?
Die freie Theaterszene ist größtenteils in größeren Städten angesiedelt. Es ist ein urban geprägtes Publikum, das kommt, um sich in verschiedenen Formaten mal mehr, mal weniger an die Grenzen der Darstellenden
Kunst bringen zu lassen. Diese Entwicklung ist konsequent, zumal, wenn Europa sowieso nur dann überleben wird, wenn es sich in alle Richtungen öffnet. Es ist gut, wenn die Kunst vorangeht.
Was ich dennoch befürchte, ist, dass die Sprache verlorengeht. Es tut mir leid, wenn ich hier das klischéehafteste Klischée erfülle, indem ich als Schriftsteller doch NUR über Sprache schreibe. Aber es geht eben auf mehreren Ebenen einher: Zum einen sehe ich, dass sich – im Zuge der Abgrenzung zum klassischeren Sprech- und Literaturtheater – viele Künstler*innen mit Sprache oder Text nicht mehr beschäftigen wollen, teils aus Angst, diese Komponente könne wie im verhassten Repräsentationstheater übermächtig werden, teils aus Angst davor, uncool zu wirken, teils aus Faulheit, teils auch
aus Mangel an Interesse.
Zum anderen ist Sprache in den meisten Performance-Arbeiten [deshalb?] einfach nur DA, unreflektiert, ungeformt, so als wäre sie eben einfach so, wie sie ist. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Englisch sich als Hauptsprache in den Darstellenden Künsten durchsetzt. Oder: Ich hätte absolut nichts dagegen.
Wenn dieses Englisch nicht oft das Englisch der Filme und Serien ist, die alle eben gerade so sehen. Es ist eine Mimikry von Sprache, die sich nicht als Mimikry zu erkennen gibt – oder nicht mal selbst als Mimikry erkennt.
Was geht dabei verloren? Was bedeutet es, wenn sich all das, was gesagt wird, aneinander angleicht? Es kommt mir vor, als wäre hier derselbe Prozess am Werk, der auch die Städte untereinander austauschbar macht, in einer einzigen visuell-taktilen Sprache, die von Cappuccino, Cupcakes und cleanen Shops. Hauptsache, alles ist urbanisiert. Dabei verstehe ich unter Urbanisierung nicht den Prozess, den eine Stadt [noch mehr] zu einer Stadt macht, im Gegenteil. Urbanisierung ist für mich ein ökonomischer Vorgang, der auf weitere Ökonomisierung der materiellen Struktur aus ist. Das Städtische dagegen ist ein Begriff, der – politisch geprägt – das soziale Netz meint, das eine Stadt darstellt.
Ein bisschen ist die sich ausdünnende Sprache wie eine urbanisierte Variante einer einstmals reichen Sprache, oder eher: einer Stadt aus vielen Sprachen. Und – so konservativ das auch klingen mag oder ist – Sprache, Sprechen heißt eben: Denken, und wenn ich nur noch auf eine Weise spreche, geht das verloren, was Denken eigentlich ist: nämlich zusammen denken. So wie Sprechen Aushandeln bedeutet.
Also: Wie können wir die Künste internationalisieren, ohne die Sprache dabei zu verlieren? Ohne dass auf einmal in den Kunstwerken alles gleich klingt und außerhalb der Kunstwerke auch? Ohne dass das Nachdenken über Sprache nur noch durch die erfolgt, die mit der Sprache wildern gehen: die Brandingexperten, die Privatisierer und die politische Rechte. Wie können wir künstlerisch, innerhalb von Formaten, und kuratorisch, von außen, die Internationalisierung nicht als Reduktion von Sprache oder
auf eine Sprache verstehen, sondern mit vielen Sprachen möglichst genau die Dinge denken? Wollen wir, statt den Kampf zu schauen, den Rest des Abends über lieber auf auf dem Parkplatz rumhängen und den fleckigen
Asphalt anstarren? Vielleicht wären wir als Parkplatz ja glücklich, und nicht als Metropole.
5 Sharing the tragedy
Jetzt haben wir eine ganze Menge Zeit in diesen Kampf gesteckt, der schon einige Jahrzehnte läuft, der Kampf darum, ob diese Welt nur noch ökonomisiert sein soll oder auch noch was anderes, und wenn ich WIR sage, weiß ich nicht genau, wen ich meine. Ich weiß nur, dass wir darauf warten, dass sich das Ende der Sackgasse auf einmal öffnet, um diese Fantasie von einem guten Leben zu enthüllen, als erfüllbar zu enthüllen, darauf warten, dass wir nicht immer wieder einen Kinnhaken bekommen, und als Gegner entpuppt sich niemand anderes als unser eigener Optimismus, unbarmherzig wie nichts.
Auch Rocky kämpft sich in seinen sechs Filmen nur nach oben, um dann wieder zu fallen. Das Leben als Kampf um Anerkennung, wie schon der deutsche Untertitel des ersten Teils deutlich macht: Die Chance seines
Lebens. Im sechsten Teil ist dann sogar Rockys Frau, Adrian, verstorben, und er bleibt wieder auf sich gestellt. Im Italodialekt flüstert Rocky immer weiter vor sich hin: Ich werde mich aufrappeln und anstrengen, zu Boden gehen, mich wieder aufrappeln und mich wieder anstrengen. Und immer weiter das neoliberale Prinzip feiern, ohne es zu wollen. Und mich irgendwann dafür schämen. Aber das dauert noch, das kommt erst
nach dem retardierenden Moment.
Im sechsten Rockyteil, in: Rocky Balboa, ist Adrian weg, die Frau, die Rocky im ersten Teil kennenlernt, in einer Tierhandlung, die immer wieder im Publikum steht und mit ihm fiebert, und die sich on the way vom Mauerblümchen zur heißen Schnitte mausert. Später ist sie die Mutter von Rockys Sohn. Und im sechsten Teil ist sie eben tot. Und das Restaurant, das Rocky betreibt, heißt nach ihr. Wer ist nun diese Adrian? Was ist das für eine Kraft, die blass erscheint, als notwendiger Teil des Plots, um sich dann, sobald sie weg ist, als unentbehrlich zu entpuppen? Sodass man sich letztlich fragt: Wäre es nicht konsequenter gewesen, statt ihr endlich Rocky sterben zu lassen?
Du und ich, wir hielten den höchsten Titel, den man in der Welt halten kann, Babe. Und immer, wenn uns andere ansahen, sahen sie nicht, dass wir das zusammen geschafft hatten. Sie sahen nur unsere Wunden, nur
die, und dachten: They look like they have been at war, these two. But it was love. Erst Adrians Abwesenheit offenbart, wie groß der Platz war, den sie einnahm. Adrian ist einerseits Rockys Stütze und damit
unentbehrlich auf seinem Erfolgsweg. Andererseits ist sie es, die ihn in jedem Teil erneut davon abhalten will, überhaupt noch zu kämpfen. Sie ist vielleicht eine Kraft, die uns Dinge erreichen lässt, die wir ohne sie nie
erreichen würden, aber auch eine, die sich gegen den Kampf als Prinzip ausspricht.
Wie ginge das konkret? Ist es zum Beispiel genug, als Festival einen Wettbewerb, den man jahrzehntelang ausgeschrieben hat, einzustellen? So wie es Impulse und FAVORITEN ja jüngst taten. Einerseits ein solides Zeichen dafür, dass man sich eben nicht an den Gesetzen kommerziellen Wettstreits orientieren will – vor allem angesichts letztlich unvergleichbarer Arbeiten. Andererseits reicht es nicht, nur die Wettbewerbe
abzuschaffen, um dem Prinzip WETTBEWERB einen Uppercut zu verpassen.
Wie entkommen wir den Geschichten des Erfolgs, die wir uns auch selbst zuflüstern, wenn wir der Politik Erfolge vorweisen wollen? Können wir die Ökonomie als Prinzip erlernen, um innerhalb dessen, was sie ermöglicht, etwas anderes aufzubauen? Etwas, dessen Erfolge vielleicht tatsächlich nicht messbar sind? Wie könnte also eine andere Form von internationaler freier Szene aussehen? Eine, die in ihrer Organisation und ihrer Art und Weise, miteinander und über Kunst zu reden, dem neoliberalem Paradigma noch mehr entgegensetzen kann? Zum Beispiel eine Form von Solidarität, die nicht an Solidität hängt.
Welche Wege gäbe es also, mit dem Geld, das zur Verfügung steht, auch andere Formen von Ökonomie zu denken? Oder – mehr noch – innerhalb der Szene diese anderen Ökonomien aufzubauen, um wiederum Menschen da heranzuführen, sie selbst aufzubauen? Könnte die Genossenschaft als alte und in vielen Fällen bewährte Form zum Beispiel nicht auch ein ganz anderes Nachdenken über Produktionsweisen und -möglichkeiten hervorbringen? Vom Boxen zum Gemeinschaftsyoga – eine Ausstiegsstory.
Dafür müsste man den Ring allerdings verlassen, und deshalb ist der gealterte Rocky vielleicht kein so schlechtes Modell. Jemand, der sich aus den Kämpfen zurückgezogen hat, und der sich niemanden sehnlicher
zurückwünscht als Adrian, nichts sehnlicher, als dass diese eine Kraft wiederkommt, die klipp und klar sagt: Hör auf, zu kämpfen! Und wenn, dann konzentrier dich auf die sozialen Kämpfe, nicht die asozialen. All those beatings you took in the ring, I took them with you. I know how you feel. Und jetzt: Lieb mich doch. Liebe mich von den Kämpfen aus.
Wie sagte schon MC Lyte 1996: Only the lonely die slowly. Also, rein in die Genossenschaft, raus aus dem Ring! In dem schwebt noch der alte Geist des Championtums. Und über ihm ein abgerissenes Banner:
HOW TO LIVE BEYOND SURVIVAL?
Jörg Albrecht ist Schriftsteller. Im Wallstein Verlag erschienen vier Romane, zuletzt Anarchie in Ruhrstadt (2014). Seine Texte hat er in intermedialen Formaten immer wieder erweitert, u.a. zusammen mit seinem Theaterkollektiv copy & waste.