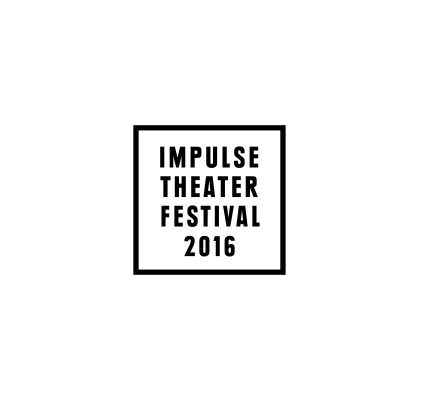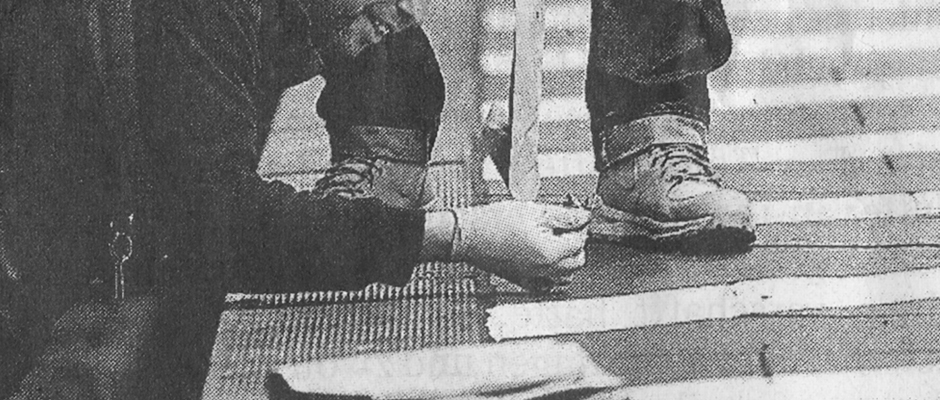
Gedanken zur Finanzierung der Freien Szene
8 Mai 2013
von PATRICK WILDERMANN
Das Gerangel um die Finanzierung der „Impulse“ verweist auf ein strukturelles Problem: Auf eine mangelnde Wertschätzung der freien Szene, die ohnehin schon leidet. An chronischer Unterfinanzierung, fehlender Planungssicherheit und anderen prekären Bedingungen.
Die liebe Not
Wobei man aufpassen muss, wenn’s ums Geld geht. Das ewige Klagen über die Selbstausbeutung der freischaffenden Künstler kann auch in die Sackgasse führen.
Wie kürzlich, während des 100 Grad-Festivals in Berlin. Der Landesverband freie darstellende Künste (LAFT) hatte anlässlich des Vier-Tage-Marathons der freien Szene zu einer Diskussionsveranstaltung in die Sophiensäle geladen, Titel: „Wie können wir noch besser werden?“. Auf der Agenda: das heiße Eisen Qualität. Ein durchaus beleuchtenswertes Thema, es ist ja schließlich auch in der freien Szene nicht alles Gold, was glänzt. Es kamen auch ein paar interessante Anstöße zusammen. Doch am Ende, im Austausch mit den anwesenden Künstlern, lief die Debatte – mal wieder – auf die liebe Not hinaus. Auf den Ärger mit Förderanträgen, die vermeintlich inkompetenten Jurys, die als ungerecht empfundene Verteilung. Schließlich: verdrossene Gesichter und keine Lösung, nirgends. So passiert es oft. Die inhaltliche Auseinandersetzung wird von Geldsorgen verdrängt.
Sicher, die Zahlen sprechen für sich: nach Angaben der Künstlersozialkasse lag das durchschnittliche Monatseinkommen in der Szene 2012 bei 1.104 Euro brutto, Schätzungen zufolge finanzieren sich 75 Prozent der freien Künstler über theaterferne Tätigkeiten quer. Christian Rakow hat diese und andere Fakten erst unlängst in einem informativen Essay über Freies Theater in Deutschland für das Goethe-Institut zusammengetragen. Man kann so ziemlich alles über die Lebens- und Arbeitsbedingungen der deutschen Künstler auch nachlesen in einem über 700-seitigen Report, den der Fonds Darstellende Künste 2010 herausgegeben und der nichts an Aktualität verloren hat.
Bloß, was folgt daraus? Die Lage der freien Szene scheint doch sattsam bekannt. Jenseits der betroffenen Künstlerkreise provoziert der Protest gegen die klammen Kassen aber nicht selten die „Mir schenkt auch keiner was“-Reflexe. Das „Kulturinfarkt“-Geschrei. Oder den Hinweis, dass Künstler ohne staatlichen Auftrag eben keine Alimentierung durch die öffentliche Hand im Stadttheaterumfang erwarten dürfen. Wogegen sich einwenden ließe, dass noch jede Stadt sich gern mit einer prosperierenden freien Szene schmückt. Nur kosten lassen will man sie sich möglichst wenig.
Im Förderdickicht der Städte
Es hilft nichts, man muss doch übers Geld reden. Aber eben differenziert. Larmoyanzfrei.
Es herrscht ja, auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, kein Mangel an Förderinstrumenten. Deutschlandweit agiert etwa die Kulturstiftung des Bundes. Die hat auch drei Mal die „Impulse“ gefördert, steigt nun aber ihren Statuten gemäß aus. Regelförderung ist nicht vorgesehen. Man kann das so richtig wie falsch finden. Klar sollten Fördertöpfe grundsätzlich offen für Neues und Nachwachsendes bleiben. Andererseits: warum nicht ein Leuchtturm-Festival wie die „Impulse“ institutionalisieren? Funktioniert anderswo ja auch. Der Hauptstadtkulturfonds – dessen Gründung 1999 als Geburtsstunde der vitalen Berliner Szene gilt – fördert beispielsweise seit 2004 die Company von Sasha Waltz mit 875.000 Euro pro Jahr. Natürlich, auch dagegen gibt es berechtigte Einwände. Mal abgesehen davon, dass die Company trotzdem unterfinanziert ist und sich Sasha Waltz mit Abwanderungsgedanken trägt. Aber prinzipiell doch kein schlechter Ansatz, dem Herausragenden die Basis zu bieten. Möglichst dauerhaft.
Kontinuität ist überhaupt das Stichwort. Nichts ist wichtiger für freie Künstler und Gruppen, als möglichst langfristig mit ihren Mitteln planen zu können – um Koproduzenten zu gewinnen, ohne die es fast nie geht. In Berlin ist die Königsklasse diesbezüglich die sogenannte Konzeptförderung, die privatrechtlich organisierte Theater sowie freie Tanz- und Theatergruppen beantragen können. Sie wird auf Empfehlung einer Sachverständigen-Jury für einen Zeitraum von vier Jahren gewährt. Was ja erstmal gut klingt. Aber man muss nicht sehr tief blicken, um die Defizite zu sehen. Zunächst mal werden in diesem Fördertopf Bühnen und Künstler zusammengewürfelt, deren Arbeitsbedingungen und Bedürfnisse sich fundamental unterscheiden. Das plüschige Revue-Theater findet sich hier neben dem Kollektiv Rimini Protokoll. Und, was weit schwerer wiegt: es stehen nur gut 4 Millionen Euro für die Konzeptförderung zur Verfügung. Davon entfallen derzeit allein auf eine Institution wie die Neuköllner Oper rund 1,1 Millionen. Was sie gerade mal in die Lage versetzt, Abendgagen von 100 Euro zu zahlen. Die Gelderverteilung in der Konzeptförderung – und nicht nur hier – gerät zur Mangelverwaltung.
Steuern rauf!
In anderen Städten sieht es freilich nicht besser aus. Für Hamburg hat 2010 der Dachverband der freien Szene eine Studie vorgelegt, die gravierende Missstände auflistet: nur an Projekte gebundene Förderung, fehlende Basisförderung, praxisferne Antragsmodalitäten, zu geringe Fördersummen, und, und, und. Klar ist vor allem: so geht’s nicht weiter.
In Berlin hat sich 2012 die Koalition der freien Szene formiert, ein spartenübergreifender Künstlerbund. Der fordert neben anderem, dass 50 Prozent der Einnahmen aus der geplanten City Tax der freien Szene zugute kommen sollen. Diese Steuer, die auf touristische Übernachtungen erhoben wird, haben andere Städte bereits eingeführt, darunter Dortmund, Köln oder Hamburg, wo sie Kulturförderabgabe heißt. Die Koalition der freien Szene kalkuliert, dass die City Tax Berlin rund 40 Millionen Einnahmen bescheren könnte – und verlangt entsprechend rund 20 davon. Jüngst hat der Berliner Finanzminister die City Tax tatsächlich für Juli angekündigt. Bloß davon, dass auch nur ein Cent in die Kultur fließen soll, ob frei oder nicht, ist gerade keine Rede. Eher wird vermutlich die Müllabfuhr begünstigt.
Die Argumente der Koalition verdienen trotzdem Beachtung. Sieben von zehn Gründen für einen Hauptstadtbesuch, das hat der Tourismusverband Visit Berlin erhoben, liegen im kulturellen Bereich. Okay, die Touristen strömen in größerer Zahl in den Friedrichstadtpalast als in die freien Spielstätten. Aber für die Anziehungskraft einer hippen Metropole ist eine lebendige freie Szene ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.
Nicht jeder Mehrwert lässt sich in Zahlen fassen. Die „Impulse“ konnten mit ihrer Ausgabe 2011 über 10.000 Besucher in 70 Veranstaltungen gewinnen. 10.000? Bei jedem besseren Zweitligaspiel eine Minuskulisse. Aber darum geht es nicht. Das Festival macht mit seinem Partnerstadt-Prinzip eben auch die Austragungsorte Köln, Düsseldorf, Mülheim an der Ruhr und Bochum zur Bühne. Für ein Bestentreffen, dessen künstlerischer Appeal auf sie zurückstrahlt.
Perspektiven und Alternativen
Zu besichtigen ist eine Szene, die sich zuletzt beachtlich professionalisiert und internationalisiert hat. Allen Kalamitäten zum Trotz. Die „Impulse“ bieten das Schaufenster dafür. Eine Plattform für die gebotene Vernetzung der freien Szene, in der vielfach der Schulterschluss vermisst wird. Und in der – wichtiges Aufbauvorhaben des Festivals – ein umfassendes Archiv fehlt, das als Materialsammlung Überblicke schafft, Zugriffe erlaubt.
Nachholbedarf besteht auch, was den internationalen Austausch zwischen Performern und Gruppen betrifft. Hier fehlt es oftmals an Kontakt und den notwendigen Förderstrukturen. In den vergangenen Jahren noch vergab das Goethe-Institut einen „Impulse“-Preis und schickte die prämierte Produktion auf Gastspielreise. Klar, dass dabei gewisse Geschmacksfilter walteten, hinsichtlich dessen, was man als deutsche Kultur für vorzeigbar hielt. Insofern erfreulich, dass die Goethe-Leute sich nun entschieden haben, stattdessen die englischsprachige Übertitelung, beziehungsweise Übersetzung der „Impulse“-Produktionen zu fördern.
Sichtbarkeit und Verständigung bedeuten freilich nicht automatisch Vernetzung.
Bezeichnend, dass die Anstöße für internationale Koproduktionen derzeit eher aus der Wirtschaft kommen. Die unternehmensverbundene Robert Bosch Stiftung hat jüngst das Programm „Szenenwechsel“ aufgelegt, das Partnerprojekte zwischen Deutschland und den Ländern Osteuropas sowie Nordafrikas fördert. Vorbildlich. Und vermutlich modellhaft. Da nicht zu erwarten steht, dass Bund, Länder und Kommunen in der nahen Zukunft ihre Kultursubventionen nennenswert erhöhen werden, dürfte für viele Künstler und Gruppen kein Weg an der Akquise alternativer Förderung vorbeiführen. Sei es durch Stiftungen, private Sponsoren, Unternehmen. Oder Förderprogramme der EU, die allerdings nach Aussage vieler Künstler ein eigenes Studium verlangen.
Die „Impulse“ werden derzeit in der Hauptsache vom NRW Kultursekretariat und der Kunststiftung NRW sowie von den vier beteiligten Städten gefördert. Man hat gesehen: das Konstrukt allein trägt nicht. Falls nicht einer der Partner seine Zuwendungen entscheidend erhöht, falls nicht ein anderer Akteur sein dauerhaftes Engagement erklärt, dann geht das Gerangel in zwei Jahren wieder los.
Patrick Wildermann, geb. 1974, lebt als freier Kulturjournalist in Berlin und arbeitet unter anderem für den Tagesspiegel, das tip-Magazin und Theater der Zeit.