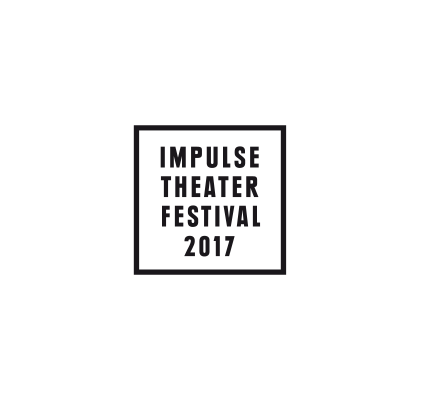Veränderung statt Veranderung
11 Mai 2017
Schwarze Theatermacher*innen zwischen Repräsentationsfalle und Bühnen-Empowerment
10 Jahre postmigrantisches Theater, Blackfacedebatte, die Gründung des Bündnis kritischer Kulturpraktiker*innen, zahlreiche Texte, die sich mit Rassismus im Kulturbetrieb beschäftigen und Schwarze1 Schauspieler*innen beklagen weiterhin die Wahl zwischen stereotypen oder gar keinen Rollen. Sie werden nach wie vor meist als „afrikanisch“ oder „migrantisch“ besetzt, spielen jedoch schon längst nicht mehr nur Prostituierte, Dealer und Putzfrauen, sondern auch Flüchtlinge und Opfer rassistischer Gewalt. So wie wir außerhalb des Theaters über Schwarze Menschen und People of Color reden, so sehen wir sie auch auf der Bühne. Sie sollen einen Problemzusammenhang verbildlichen, soziale Missstände aufzeigen, eine Debatte auf die Bühne bringen. So konnten sich stereotype Besetzungsmuster etablieren, die sich immer an aktuelle Vorstellungen von Schwarzsein anpassen lassen. Die Rollen verändern sich also, aber sie bleiben „Schwarz“. Zu Rollen, in denen ihre „Hautfarbe“ weder zur Charakterisierung der Figur beiträgt noch Teil der Handlung oder sonst von Relevanz ist bleibt Schwarzen Schauspieler*innen der Zugang verwehrt. Von einer weißen Norm ausgehend bleiben sie die Fremden und die Anderen.
Doch etwas hat sich verändert: Künstler*innen of Color haben sich vernetzt. Es gibt inzwischen so etwas wie eine Szene in der Szene. Kolleg*innen, die von Rassismus betroffen sind haben immer mehr Räume und Gelegenheiten zum Austausch von Erfahrungen geschaffen. Ein Beispiel ist die erste Indaba Schwarzer Kulturschaffender, die Anfang 2015 am Berliner Ballhaus Naunynstraße stattfand. Eine geschlossene Veranstaltung der Schwarzen Community, die nur nachmittags zur Präsentation der Diskussionsergebnisse auch für weißes Publikum geöffnet wurde. „Indaba“ ist ein IsiZulu Begriff und bedeutet so viel wie „Zusammenkunft“, aber auch „Disput“ oder „Affäre“ Ein Wort also, das nicht nur Sinn und Zweck dieses Treffens beschreibt, sondern auch das Verhältnis der Teilnehmenden zum Kulturbetrieb. Auf der Indaba konnte Fragen nachgegangen werden, die bei Veranstaltungen mit weißen Kolleg*innen meistens zu kurz kommen. Es gab ein höheres Einstiegsniveau, da nicht damit begonnen werden musste zunächst einmal die Probleme und Missstände aufzuzeigen. Es ging also nicht darum, ob es Rassismus im Theater gibt und wie dieser sich äußert, sondern direkt um Strategien wie man auf struktureller und auf künstlerischer Ebene als Schwarze Theaterschaffende damit umgehen kann und welche Konsequenzen es aus diesen Erkenntnissen für die eigene künstlerische Arbeit zu ziehen gilt.
So wurde immer wieder hinterfragt, in wie weit die Notwendigkeit besteht, sich auf rassistische Strukturen einzulassen, um überhaupt arbeiten zu können und welche Möglichkeiten es gibt eigene Position – Schwarze Positionen – auf und hinter der Bühne zu vertreten. Denn die Anpassung an weiße Vorstellungen von Schwarzsein behindert nicht nur die eigene künstlerische Entfaltung, sie hat auch negative Auswirkungen auf das Leben außerhalb des Theaters, den eigenen Alltag und den der Familie.
Die Klischeerollen, die in Film, Fernsehen und auf der Bühne übernommen werden, verfestigen die Zuschreibungen, mit denen Schwarze Menschen im Alltag konfrontiert sind. Sicherlich ist es in erster Linie die Aufgabe der weiß besetzten Fördergremien, der weißen Produzent*innen, Intendant*innen und Dramaturg*innen rassistische Stereotype zu verbannen. Die Rollenangebote als Schwarze Prostituierte, Drogendealer und sogenannte „illegale Einwanderer“ sollten Schwarzen Schauspieler*innen gar nicht erst gemacht werden. Sie sollten gar nicht erst vor die Entscheidung gestellt werden, ob sie ihre Miete zahlen können, indem sie diese Rollen annehmen oder ob sie ablehnen, ihre Würde bewahren und den Kreislauf der Zuschreibungen durchbrechen.
Doch obwohl sich die Angebote nur schleichend ändern, gibt es in den letzten Jahren auch im deutschsprachigen Raum große Fortschritte was Präsenz und Selbstrepräsentation Schwarzer Künstler*innen betrifft. Dies ist vielen verschiedenen Initiativen zu verdanken, die aus der Schwarzen Community heraus entstanden sind. Wobei es wichtig ist sich an dieser Stelle festzuhalten, dass es diese Eigeninitiativen schon immer gab, denn Schwarze Menschen nutzen Kunst als widerständiges Mittel der Selbstdefinition und Selbstbestimmung, seit es Rassismus gibt. Es brauchte wohl die Rassismusdiskussionen der letzten Jahre um diesen Projekten auch die verdiente Aufmerksamkeit zu schenken und sie für ein Publikum außerhalb der Community sichtbar werden zu lassen. Die Kritik und die Forderungen an bestehende Strukturen verdeutlichten die Notwendigkeit Schwarzer Räume und Initiativen. So können wir jetzt Schwarze Künstler*innen sehen, die dem weißen Selbstverständnis vermehrt mit ihren Produktionen die eigene Perspektive entgegen setzen und selbst entscheiden welches Bild Schwarzer Menschen sie vermitteln wollen, um so einen eigenen, widerständigen Beitrag zur Repräsentation von Schwarzsein zu leisten. Dies ist auch als Akt der Selbstermächtigung zu verstehen. Empowerment für diejenigen, die auf der Bühne stehen und die Personen im Zuschauerraum, die deren Erfahrungen teilen. Trotzdem sind damit noch nicht alle Probleme gelöst, denn wir sprechen von kleinen Bühnenmomenten in einem sich als mehrheitlich weiß verstehenden, bürgerlichen Theaterbetrieb. In diesem Kontext treten Schwarze Bühnenkünstler*innen in vielen Fällen vor ein weißes Publikum. In der Auseinandersetzung mit afrodeutschem Theater ist es relevant darauf einzugehen, denn bei allen Entscheidungen und Vorkehrungen, die getroffen werden können (und viele Schwarze Kolleg*innen verbringen viel Zeit damit sich darüber Gedanken zu machen), liegt es nicht in ihrer Macht, wie sie und ihre Arbeiten gelesen bzw. aufgenommen werden. Während weiße Künstler*innen das Privileg haben, zuerst in ihrer Profession wahrgenommen zu werden, sieht man Schwarze Künstler*innen in erster Linie als Schwarze – was mit entsprechenden Erwartungen und Zuschreibungen verknüpft ist. In ihrem Beitrag „Kunst“ im Nachschlagewerk „Wie Rassismus aus Wörtern spricht – (K)erben des Kolonialismus“ bezeichnet Sandrine Micossé-Aikins den Blick als eines der wichtigsten Instrumente weißer Dominanz:
“Künstler_innen of Color arbeiten in Deutschland in einem restriktiven Raum, der sie zwar einerseits auf ihre Herkunft/ ihr Aussehen reduziert und von ihnen erwartet, sich permanent dazu zu äußern, andererseits jedoch nicht alle Aussagen oder Tätigkeiten zulässt, sondern nur jene, die den Vorstellungen des hauptsächlich weißen Publikums entsprechen und von diesem auf die Gesamtheit der Gruppe bezogen werden, denen die Künstler_innen zugeordnet werden – ein Phänomen, dass Kobena Mercer als burden of representation benennt. Das geht soweit, dass der ersehnte Ausdruck der Andersartigkeit von Kunstschaffenden of Color in deren Arbeiten hineingelesen wird – selbst wenn er gar nicht vorhanden ist.“
Während weiße Künstler*innen also Künstler*innen sind bleiben Schwarze Künstler*innen weiterhin Schwarze Künstler*innen deren Schwarzsein immer mitgelesen wird.
Das Wissen um diese Umstände ist ein häufiger, blockierender Faktor in der künstlerischen Auseinandersetzung. Viele Kolleg*innen sprechen von Repräsentationsdruck und einer besonderen Angst vor „Fehlern“: Was, wenn ich Stereotype reproduziere? Was, wenn ich eine Aussage treffe, mit der sich nur wenige andere Afrodeutsche identifizieren können, die aber auf sie zurückfällt, weil ich diese Äußerung als Schwarze Person auf der Bühne gemacht habe und dabei ungewollt als Stellvertreter*in Schwarzer Menschen in Deutschland gelesen werde? Je mehr Aufmerksamkeit außerhalb von Community-Veranstaltungen diese Arbeiten bekommen, desto größer wird der Druck.
“In front of white audiences every presentation of art by Black individuals becomes symbolic in the context of racial identity. This is an underlying premise you may want to challenge. I regard it as true. Whether you recite poetry, rap, or sing, whether you play theatre or seek artistic expression by spitting at the audience dressed in nothing but finger paint and a strip-on vacuum cleaner; any Black performer in front of a predominately white audience is confronted with a dilemma of representation.”
- Sandrine Micossé-Aikins & Sharon Dodua Otoo: “The little book
of big visions. How to be an artist and revolutionize the world”
In vielen Produktionen wird das Dilemma gleich mitgedacht. So spielen in den Arbeiten Schwarzer Künstler*innen Identitätsverhandlungen und Repräsentationspolitik häufig eine wichtige Rolle.
Um der stereotypen Darstellung Schwarzer Menschen auf der Bühne bewusst entgegenzuwirken und ein neues empowerndes Selbstbild zu kreieren, treffen viele Kolleg*innen die Entscheidung ihr Schwarzsein aus eigener Perspektive und mit eigenen Anliegen zu thematisieren. Dabei versuchen sie auch weißen Zuschauer*innen diese Anliegen näherzubringen, der wichtigere Aspekt ist jedoch die Verbindung die über die geteilten Erfahrungen mit dem Schwarzen Theaterpublikum geschaffen wird. Theatergänger*innen, die über weite Teile ihrer Theatersozialisation keine Möglichkeit hatten ihre Geschichte(n) auf der Bühne zu sehen werden so zu den engsten Mitwisser*innen der Personen die auf der Bühne stehen. Sie teilen etwas, das sich dem weißen Publikum entzieht. Dies ist ein entscheidender Teil einer Theaterpraxis, die strukturellem Rassismus im Kulturbetrieb entgegenwirkt und Schwarze Menschen und POC als Akteur*innen und Zuschauer*innen ernst nehmen soll. Das bewusste Spiel mit Sehgewohnheiten und Erwartungen sowie die explizite Auseinandersetzung mit rassistischen Zuschreibungen sind ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit. Eine Möglichkeit aus der „Repräsentationsfalle“ herauszukommen, indem das Thema Repräsentation klar auf der Bühne verhandelt und das Wissen über den weißen Blick der immer im Raum ist, ausgestellt wird. Sie machen Kunst mit doppeltem Bewusstsein. Wünschenswert wäre es, dass das weiße Gegenüber für das Bühnengeschehen irrelevant wird. Nicht, dass ein weißes Publikum aus den Vorstellungen ausgeladen werden soll, es geht darum dass es nicht mehr zur Norm erhoben wird, nicht mehr als die Gruppe betrachtet wird für die Show eigentlich gemacht ist. Künstler*innen sollen sich von dem Gedanken frei machen können für ein weißes Publikum zu produzieren.
Simone Dede Ayivi arbeitet als Performerin, Regisseurin, Autorin und Kulturwissenschaftlerin an der Generierung einer neuen Sehgewohnheit durch Schwarze Selbstrepräsentation im Theater- und Performancekontext. Mit ihren Arbeiten sucht sie nach einer neuen afrodeutschen Perspektive, die in Bezug zu ihren eigenen Identitätsverhandlungen steht.
____________________
1 Um zu verdeutlichen das “Schwarz” kein beschreibendes Farbadjektiv ist, sondern eine politische empowernde Selbstbezeichnung wird es in diesem Text groß geschrieben. Um hervorzuheben, dass auch weiß eine Konstruktion ist und nicht den Farbton menschlicher Haut beschreibt steht es hier kursiv.