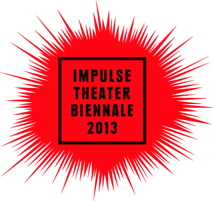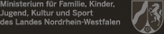Museen sind die Schachteln unserer Erinnerung
21 November 2012
Die Kulturwissenschaftlerin CHRISTINA VON BRAUN über die historische Rolle des menschlichen Körpers für den Wert des Geldes, über nationales Gedächtnis und gesellschaftliche Wirksamkeit als Maßstab für die Kunst.
In deinem letzten Buch, „Der Preis des Geldes”, hast du die These aufgestellt, dass es so etwas wie die Ablösung des Goldstandards – also der Deckung des Gegenwerts von Geld durch tatsächlich hinterlegtes Gold – durch den menschlichen Körper gibt. Was bedeutet das?
Der Körper löst das Gold nicht ab, sondern ist schon immer eingewoben in die Deckung des Geldes. Das Gold war von Anfang an von mythischem Wert, es ist rar, es ist schön und es hat durch seine Knappheit eine gewisse Qualität, aber sein Wert wurde mythisch festgelegt. Die babylonischen Priester haben den Wert von Gold und Silber mit 1:13 1/3 festgelegt, weil das den Umlaufzeiten von Sonne und Mond zueinander entspricht. Die Chinesen und Japaner haben das viel pragmatischer mit 1:10 gelöst, aber das war genauso willkürlich. Gold war von Anfang an von mythischem Wert und dadurch nur einer Konvention geschuldet, um den Wert eines Geldes zu garantieren, das keinen materiellen Wert hat.
Davon hat sich die westliche Gesellschaft gelöst, als sich herausstellte, dass man für die Industrieproduktion mehr Geld braucht, als durch Gold garantiert werden kann. Daneben gab es immer die Wertdeckung des Geldes durch den Souverän, der beglaubigt, dass eine bestimmte Währung so und so viel wert ist. Diese beiden Formen der Deckung haben zunehmend an Glaubwürdigkeit verloren. Erstens, weil sich das Geld vom materiellen Wert gelöst hat. Zweitens aber auch, weil viele Herrscher ihre Macht missbrauchten, indem sie unterwertiges Geld oder zu viel Geld herausgaben – so wurde die Glaubwürdigkeit der vom Souverän herausgegebenen Währung verspielt, um die eigene Staatskasse zu sanieren.
Die dritte Form der Deckung des Geldes stammt aus dem sakralen Opferkult in Griechenland, wo die Teilnehmenden an der Opfermahlzeit einen kleinen Spieß, den obolós, bekamen. Diese kleinen Spieße hatten einen Wert, weil sie im Tauschgeschäft mit den Göttern eine Rolle gespielt hatten; die Priester beglaubigten diese Opfergabe, und dieses ‚Geld’ gehörte der Gottheit. Aus den Spießen wurden Münzen, auf denen nur noch ein Opfersymbol aufgeprägt war, und diese gingen vom sakralen in den profanen Handel über.
Hinter jeder Opferhandlung steht aber symbolisch immer das Menschenopfer: der, der opfert, gibt etwas von sich selbst – oder das Opfer ist nichts wert. Das Menschenopfer wurde zwar substituiert: durch ein Tier oder eine Frucht. Aber gemeint war immer der Mensch selbst. Als die Opfersymbole in den profanen Handel übergingen, war es also der, wenn auch symbolisch geopferte, menschliche Körper, der dem Geld seine Deckung verlieh.
Du beschreibst, wie diese historischen Verknüpfungen mit dem heutigen Biokapitalismus zusammenhängen. Das sind doch zwei sehr unterschiedliche Register…
Nein, sie hängen eng miteinander zusammen. Wenn in den Tempeln der Fruchtbarkeitsgöttin Opfer dargebracht wurden, dann damit sie die Felder befruchteten, die Landwirtschaft blühen ließen. Diese Vorstellung geht auf das Geld über. In den Tempeln der Fruchtbarkeitsgöttinnen befanden sich auch die Münzstätten. Bis heute ist unser ganzes ökonomisches Vokabular durchsetzt von Bildern des Wachstums, des Zyklus’, der Blüte. Im ökonomischen Diskurs steckt dieser Fruchtbarkeits- und Vermehrungsgedanke, der dem Opferkult zugrundelag. Und auf der anderen Seite gibt es den, der geopfert werden muss. Es gibt verschiedene Opferformen, die bis heute am menschlichen Körper praktiziert werden. Der Biokapitalismus, bei dem das Geld in die Natur einwandert und diese wachsen lässt, gehört in die Inkarnations- oder Fruchtbarkeitslogik des Geldes, die ihrerseits auf der Opferlogik basiert. Deshalb hat sich die ganze Geldwirtschaft im christlichen Kulturraum auch weiterentwickelt, denn die christliche Heilsbotschaft mit Christus als Opfer einerseits und Christus als dem ‚Fleisch gewordenen Wort’ oder Zeichen andererseits, unterliegt einer ähnlichen Logik. Nicht durch Zufall nahm die Hostie im Mittelalter die Form der Münze an.
Die Entwicklung des Geldes und die Logik der Fruchtbarkeit sind – wie du erwähnt hast – gebunden an den Souverän, an den Staat und damit auch an Territorien. Wie zeigt sich das im Kontext der sich später entwickelnden Idee der Nation?
Das deutsche Reich emittierte 1926 eine neue Reichsmark, die durch den fiktiven Wert des gesamten deutschen Territoriums gedeckt war – gleichgültig, ob im privaten oder im öffentlichen Besitz. Als Deckung wird also der Grund und Boden angenommen, den ein Staat umfasst. Das ist allerdings problematisch. Erstens können Grund und Boden wachsen – etwa durch Irrigation; oder auch verschwinden – etwa durch den steigenden Meeresspiegel, wie es zur Zeit durch die Erderwärmung der Fall ist. Hätte Holland nicht seine Deiche, wäre ein Drittel des gesamten Landes unter Wasser. Hinzu kommt aber zweitens, dass mit dem Agrarkapitalismus, der dem Industriekapitalismus vorausging, Grund und Boden zu einer Ware wurden. Und eine Ware, deren Preis schwankt, kann nie und nimmer das Geld garantieren, mit dem man diese Ware kauft. Grund und Boden wurden obsolet als Garant des Wertes einer Währung, zumindest in den Ländern, wo sie kein Gemeinschaftseigentum sind und die Allende zugunsten von privatem Grundbesitz aufgegeben worden war. Dieser Prozess ging dem Industriekapitalismus voraus. Insofern können Grund und Boden nicht mehr als letzte Deckung des Geldes funktionieren.
Welche Rolle spielt die Kunst in diesem Spiel?
Die Kunst stellt in meinen Augen den letzten großen Versuch dar, noch einmal sowas wie materielle Werte herzustellen. Es ist kein Zufall, dass der Kunstmarkt im Holland des 17. Jahrhunderts entsteht. Das hat damals schon viele Reisende gewundert, warum Kunst dort so eine große Rolle spielt. Tatsächlich ersetzte Kunst in Holland etwas, was fehlte, nämlich Grund und Boden. Hinzu kam, dass Holland zu den ersten Gebieten gehörte, die anfingen, eine Börse einzurichten, und mit virtuellen Währungen – gedeckt durch Tulpen, die nur noch als Katalogbilder gehandelt wurden – zu spekulieren. Mit der Börse rückte allmählich die Kunst als eigene Währung in den Mittelpunkt. In Holland findet die Kunst zum ersten Mal ihren Markt.
Überhaupt hat Kunst viel gemein mit dem Geld: nicht nur wegen der schönen Bilder auf den ersten Aktien. Wie das Geld ist auch der Wert der Kunst schwankend; und der Künstler selbst ist die paradigmatische Gestalt des Unternehmers, der Kreative des Industriekapitalismus. Aber, anders als Geld, ist (oder war) Kunst etwas, was du anfassen und berühren kannst; sie hat also nicht die Flüchtigkeit von Papiergeld. Und sie erweckt den Anschein, dass sie sich nicht so schnell reproduzieren lässt, womit Warhol später mit seinen Multiples gespielt hat. Zunächst aber gab es die Vorstellung einer Einmaligkeit des Kunstwerks, das deshalb auch einen bleibenden Wert bietet. Das macht die Kunst bis heute zu einer der letzten Bastionen gegen die Virtualisierung des Geldes, der weder Gold noch Grund und Boden entgegenwirken können, und gegen die Deckung durch den menschlichen Körper, der ja selber vergänglich ist.
Wobei der menschliche Körper ja durchaus auch in der Kunst auftaucht – in deinem Buch gibt es ein Kapitel „Der Körper des Künstlers“. Du hast jetzt vor allem von bildenden Künsten gesprochen. In den performativen Künsten ist der Körper des Künstlers ja nochmal ganz anders involviert und gleichzeitig führt die Flüchtigkeit des Ereignisses dazu, dass sich die künstlerische Arbeit nicht ganz so leicht instrumentalisieren lässt.
Die Künstler haben von Anfang an versucht, mit dieser Doppelrolle zu spielen – zum Teil, um den Wert des ‚einmaligen Kunstwerks’, nämlich ihres Körpers in Szene zu setzen; zum Teil aber auch, um diese Vorstellung zu dekonstruieren: Sie wollen zeigen, dass sie keine Währung sind, keine ‚lebende Münze’, wie Pierre Klossowski es so schön gesagt hat; sie lehnen es ab, Währungsgarantien zu produzieren. Je mehr der Kunstmarkt die Kunst instrumentalisieren wollte, desto stärker haben sich Künstler damit auseinanderzusetzen gehabt: entweder sie setzten ihren eigenen Körper ein oder sorgten dafür, dass sich die Kunst als eine flüchtige Kunst erweist. So wie der Kapitalismus die Kapitalismuskritik hervorgebracht hat, bringt auch die Instrumentalisierung der Kunst als Währung die Kritik der Künstler am Kunstmarkt mit sich.
Was uns auch bei der Konzeption von Impulse beschäftigt ist, dass Kunst sehr oft durch staatliche Mittel finanziert wird und dadurch auch als Aushängeschild der Nation gesehen wird – also zum Beispiel als Theaterarbeit im Namen Deutschlands auf Tour geht, unterstützt vom Goethe-Institut. Oder die nationalen Sammlungen in der bildenden Kunst, die ja eine Geschichte erzählen, die konsensfähig sein muss. Dieses Verhältnis ist ja auch an eine Wertschöpfung gebunden…
Museen sind die Schachteln unserer Erinnerungen geworden, damit aber auch im weiteren Sinne das Kulturgut einer Nation. Die kollektive Erinnerung, die gleichzeitig eine Legitimierung der Gemeinschaft ist, ist dort eingelagert. Nun lösen sich die Nationalgemeinschaften, die ohnehin ein Konstrukt sind, im Moment weitgehend auf – die europäische Gemeinschaft wird einen neuen gemeinschaftlichen Kasten verlangen, in den dann die kollektive Erinnerung Europas eingelagert wird. Es gibt Kunsttheoretiker, die sagen: Warum macht man eigentlich nicht die Kunstwerke, die in unseren Museen lagern, zur Währungsgarantie? Und in der Tat: Vielleicht wäre es besser, kulturelle Werte, statt des menschlichen Körpers, zum Garanten des Geldes zu machen. Jedes Mal, wenn eine Bank pleite geht oder eine Währung ihre Glaubwürdigkeit verliert, haben Menschen dafür einen existenziellen Preis zu zahlen – sei es durch Arbeitslosigkeit oder Verlust der Behausung. Sie zahlen dann den Preis des Geldes. Warum lassen wir nicht die Kunst diesen Preis zahlen? Dazu haben schon einige Künstler seit Marcel Duchamp schöne und ironische Werke gemacht.
Ich hab mir in letzter Zeit einige Gedanken darüber gemacht: Wie kann man neue Maßstäbe dafür finden, was Kunst eigentlich wert ist oder rechtfertigt? Der einzige Maßstab, der im Moment gilt, ist der Marktwert eines Werkes. Und vielleicht ließe sich auch hier die Parallele zur Währung herstellen: Es gibt drei Faktoren, die eng miteinander zusammenhängen: Das Eine ist der Glaube an die Währung. Eine Währung funktioniert, wenn alle, die damit zu tun haben, daran glauben. Der zweite Faktor ist, dass die Instanz, die diese Währung emittiert, glaubwürdig sein muss. Ich muss an Europa glauben, damit ich auch an die Währung, die Europa emittiert, glaube. Das ist genau die Krise, die wir im Moment haben: Erst wenn wir alle Europa für wichtiger halten als die einzelnen Nationen, dann wird der Euro funktionieren. Dann kommt noch ein dritter Faktor hinzu und der macht dieses Triangel aus. Über lange Zeit wurde die Währung durch die Herrscher, durch die Regierung garantiert. Dann durch den Nationalgedanken, der heute – außer bei Populisten – seine Glaubwürdigkeit veloren hat. Aber es gibt einen Faktor, durch den eine Gemeinschaft Glaubwürdigkeit erlangen kann: soziale Gerechtigkeit. Natürlich muss das, was soziale Gerechtigkeit ausmacht, in jedem Kontext anders definiert werden. Aber das Triangel – Glaube an Gemeinschaft, Geld und soziale Gerechtigkeit – ist entscheidend. Könnte dies nicht auch ein Maßstab für die Kunst sein? Vielleicht wird der Wert, den wir Kunst zuschreiben, irgendwann darin bestehen, dass sie etwas bewirkt. Sagen wir mal, die Occupy-Wall-Street-Leute hätten nicht nur Unruhe in den Banken geschaffen, sondern neue Konzepte, wie in der Ökonomie etwas funktionieren könnte, und diese Wirksamkeit wäre durch intellektuelle oder kreative Prozesse gelaufen, dann würde man sagen: Hier, das ist Kunst! Dieses Werk oder dieses Ereignis ist wirksam geworden. Und das würde dann auch den Wert dieser Kunst ausmachen.
Das Gespräch führte Stefanie Wenner.
Christina von Braun ist Professorin am Institut für Kulturwissenschaft der HU Berlin, Mitbegründerin und Leiterin des Zentrums Jüdische Studien Berlin-Brandenburg, sie war u.a. Initiatorin, Mitbegründerin und Leiterin des Studiengangs “Gender Studies” an der HU Berlin, seit 2002 ist sie außerdem Mitglied des Präsidiums des Goethe-Instituts und seit 2008 2. Vizepräsidentin desselben. Zahlreiche Publikationen und Filme, z.B. „Nicht-Ich. Logik, Lüge, Libido.”, Frankfurt a.M. 1985, „Verschleierte Wirklichkeit. Die Frau, der Islam und der Westen.” Gem. mit B. Matthes, Berlin 2007, „Die Erben des Hakenkreuzes. Die Geschichte des Hakenkreuzes. Die Geschichte der Entnazifizierung in beiden deutschen Staaten.” (WDR 1988, 120 Min.), „Die Angst der Satten. Zur Geschichte des Hungerstreiks als politische Waffe.” (WDR, 1991, 45 min.). Ihr Buch „Der Preis des Geldes. Eine Kulturgeschichte” erschien 2012 in Berlin.