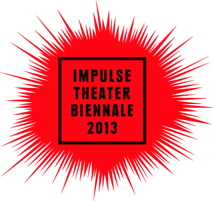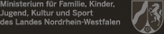Wunde Schlingensief
1 Juli 2013
FRANK RADDATZ über den den Zusammenhang von Krankheit, Kunst und Geschichte sowie die Notwendigkeit, den Knoten zu schürzen, den Wagner für die deutsche Kunst geknüpft hat.
Als ich hörte, dass Christoph Schlingensief seine Krebserkrankung zum Gegenstand einer Inszenierung macht, fiel mir spontan eine Definition Heiner Müllers ein: „Die zentrale Funktion von Revolution, das hat Büchner schon über die Französische Revolution gesagt, ist die Veröffentlichung des Sterbens“. Den verbannten Tod sichtbar zu machen, ist eine Geste von enormer politischer Brisanz; dem Sterben eine öffentliche Präsenz zu verleihen, Dreh – und Angelpunkt kulturrevolutionärer Maximen. Aus ihr speist sich, gestützt auf Walter Benjamin, Müllers Kapitalismuskritik, die weit über die Fragen sozialer Gerechtigkeit hinausgreift. Ob er vorschlägt, fliegende Friedhöfe zu installieren, das Museum des Alltagsmenschen einzurichten, oder mit Francis Ponge dafür plädiert, in Särgen Kameras anzubringen, die das Verwesen des Körpers übertragen, stets ist der Wunsch maßgeblich, Tod und Sterben der Sphäre der Nicht-Präsenz zu entreißen. Die auf der Grenzlinie zwischen Diesseits und Jenseits angesiedelten Verbildlichungen haben existenziellen Charakter, dienen dem „Respekt vor der Wirklichkeit, vor dem Leben“. Schlingensiefs Projekt „Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir“ reiht sich nahtlos in diesen Entwurf ein, den Tod als Teil des Lebens zurückzugewinnen.
Lässt sich auch nur schwer vorstellen, dass Müller die eigene Krebserkrankung als Intendant des Berliner Ensembles mit einem Oratorium orchestriert, in dem Brecht und Beckett, Aischylos und Ezra Pound, Marx und Nietzsche auftreten, so liegt das an der Scheu, das eigenen Wesen derart in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen, während Millionen andere in vergleichsweise namenloser Anonymität verscheiden. Einar Schleefs Ende markiert diesen Kontrapunkt. Christoph Schlingensief ließ sich durch diese Angst vor der Hybris glücklicherweise nicht einschüchtern und setzt im Performativen um, was Müller als generelle Richtung vorgibt und nur als Schreibender realisiert. In seiner Lyrik erhebt er die Krankheit, seine Operationen, sein Sterben zum Gegenstand des ästhetischen Interesses.
ICH KAUE DIE KRANKENKOST DER TOD
Schmeckt durch
Nach der letzten
Endoskopie in den Augen der Ärzte
War mein Grab offen
Beinahe rührte mich
Die Trauer der Experten und beinahe
War ich stolz auf meinen unbesiegten
Tumor
Einen Augenblick lang Fleisch
Von meinem Fleisch
Der Text, geschrieben im Dezember 1995 knapp drei Wochen vor seinem Tod, steht in einer Reihe lyrischer Gestaltungen, die Krankheit zu dokumentieren, und lässt sich problemlos neben Schlingensiefs künstlerische Versuche stellen, offensiv mit der Diagnose umzugehen.
Bis vor wenigen Monaten schien mir der mit den Mitteln der Kunst auf der Bühne exponierte Krebs, ohne Rest in den von Müller geschaffenen kulturkritischen Überhang aufzugehen. Doch dann begann mich etwas in diesem Zusammenhang zu irritieren, dem ich mich auf diesen Seiten nähern möchte. Es geht um die Differenz zwischen der Präsentation des Sterbens und der Ursache der Krankheit, wie Schlingensief sie selbst interpretiert. Letztlich eine deutsche Krankheit demnach, denn Schlingensief deutet den Krebs als eine Wunde, die ihm von der Geschichte zugefügt wird. Die Kontingenz dieses Sterbens erzeugt Spuren von Sinn, welche zeitgenössische Hypostasierung der Präsenz auf der Bühne eher negieren. Falls tatsächlich gilt, dass nur der Speer, die Wunde schließt, der sie schlug, so muss sich das Theater der Präsenz der Geschichte versichern, damit aber transformiert sich sein Wesen. Doch der Reihe nach.
In einem kürzlich bei „Lettre International“ erschienenen Mini-Essay beschrieb ich die Differenz zwischen neuen Theaterformen aus dem Kontext des Freien Theaters und dem herkömmlichen Repräsentationstheater durch konträre Situierungen in der Zeit. So intendieren beispielsweise Wagners Renaissance der Tragödie, Bertolt Brechts wissenschaftliches Theater oder Müllers besagter Dialog mit den Toten Veränderungen in einer Zukunft, die in einem Kontinuum von Geschichte gedacht wird. Selbst die auf Beckett gestützten, apokalyptischen Reigen Müllers besingen die, wenn auch verlorenen Möglichkeiten eines Anderen in der Geschichte: „Something is rotten in this age of hope“. Zwischen dem unerreichten Morgen, dem stagnierenden Heute und den mythischen Anfängen stiften die Texte Zusammenhänge und begeben sich in eine – wenn auch vergebliche – Suchbewegung nach der Lücke im System katastrophaler historischer Entwicklungen.
Doch seit dem Epochenbruch von 1989 oder spätestens dem 11. September weicht die Ausrichtung an einer zu erringenden Zukunft einer Fixierung auf das Hier und Heute. Die Zukunftsgewissheit einer vom Fortschritt getragenen Moderne weicht immer stärker einer bedrohlichen Zukunftserwartung. Diese Umwertung in der allgemeinen Bewusstseinslage wirkt in die Ästhetik hinein. Insbesondere für den postdramatischen Typus ist Zukunft keine Option mehr und wird die Gegenwart zum allein verbindlichen Horizont einer Bearbeitung von Realität. Während das Repräsentationstheater im Fluss der Zeit etabliert und einem Begriff der Geschichte verpflichtet ist, siedeln die neuen Theaterformen auf dem Saum in der Zeit, den Hans-Ulrich Gumbrecht „Unsere breite Gegenwart“ nennt. An die Stelle epochaler Überschreitungen und geschichtlicher Unterbrechungen tritt die Auseinandersetzung mit dem Alltag.
Über die Vor- und Nachteile beider Modelle zu streiten, erscheint müßig, werden sie als Symptom gelesen. Zeugt das eine von der Zuversicht in einen mehr oder minder offenen Horizont, reagiert das andere im Gegenteil auf dessen Verschluss. Trotzdem lassen sich insbesondere angesichts eines politisch gefassten Performativen signifikante Unterschiede festhalten. So operiert das Theater der mimetischen Tradition seit dem tragischen Beginnen mit Tabubrüchen wie Mord, Brudermord, Vater- und Muttermord, Inzest etc. Diese gesamte Skala des Ungeheuerlichen kann das Theater der Präsenz auf der Bühne nicht einbringen. Wo bei Shakespeare das Monströse menschlichen Handelns zu Tage tritt, verhandeln She She Pop nicht zufällig den zivilen Umgang mit der Generationsablösung und testamentarischen Fragen oder treten bei Volker Lösch Gesetzesbrecher auf, die ihre Strafe verbüßt haben. Tabubrüche, die der symbolische Raum leistet, sind den Experten des Alltags auf offener Bühne nicht zumutbar. Hier endet die Wirkungsmacht des Authentischen. Das Böse muss draußen bleiben, stattdessen beherrschen Bearbeitungen des realen Alltags die Szene. Das grenzüberschreitende Dionysische und das apollinisch Maßvolle stehen sich unvermittelt gegenüber. Genau an dieser Stelle durchbricht Schlingensief die Trennungslinien. Denn der Tod bzw. das Sterben sind sowohl alltäglich wie tabuisiert. Weder ein von Statistik erfasstes und mit Expertenwissen umrahmtes Sterben noch die wie auch immer virtuose Simulation des Todes respektive mimetische Symbolisierung reichen an die Veröffentlichung des realen Sterbens heran. Die performative Veröffentlichung des Sterbens ist an Intensität, an Wahrheit und Authentizität, nicht zu überbieten.
Schlingensief – in meiner Applikation ein Halbgott des postdramatischen Theaters, – macht letztlich für seinen physischen Tod einen Aufenthalt im Bannkreis des mimetischen Theaters, des Theaters der Geschichte verantwortlich. Genauer sein Aufenthalt in Bayreuth, wo er 2004 „Parzifal“ inszenierte. Im Gespräch mit Peter Laudenbach stellte Schlingensief bereits Jahre vor Erkrankung, im Juli 2004 eine erstaunliche These auf: „Vielleicht bin ich schon tot und das Bild ist eine Erinnerung an das letzte Leben. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich nach “Parsifal” Krebs kriege, wie Heiner Müller.“ (Der Tagesspiegel, 26.7.2004). Heiner Müller hatte 1993 in Bayreuth „Tristan und Isolde” inszeniert. Im folgenden Jahr wurde bei ihm zwar Krebs diagnostiziert, doch dass Müllers Krebs durch die Auseinandersetzung mit Wagner verursacht wurde, wie es das Statement zwar nicht ausdrücklich behauptet, aber doch nahelegt, wurde so nicht diskutiert. Vielmehr war von einem Wendekrebs die Rede.
Wie auch immer. In den kommenden Jahren wird aus der Vorahnung eine Tatsache: „…ich bin inzwischen der festen Überzeugung, dass ich genau in der Bayreuth-Zeit eine Grenze überschritten habe. Ich wollte die Inszenierung so gut machen, dass ich mich von dieser Musik genau auf den Trip habe schicken lassen, den Wagner haben will. Er selbst war vielleicht abgebrüht genug und hat das abreagieren können. Aber ich glaube inzwischen, dass es sich tatsächlich um Todesmusik handelt, die nicht das Leben sondern das Sterben feiert. Da bin ich fast so weit zu behaupten, ja, da haben die Nazis viel Spaß gehabt, das war genau deren Welt. Da konnten sie alle mitmarschieren, da haben die alle gesessen und waren plötzlich ganz erregt, weil das ihre Wahrheit war. Das war ihr Ziel: irgendwann im Hinterhöfchen mit dem Benzinkanister unterm Arm und einer Zyankali–Kapsel im Maul den Tod zu zelebrieren.“
Was mich bei der Re-Lektüre dieser Aussagen verstört, ist der Faktor, dass der Held des Performativen ausgerechnet auf dem Parcours eines Theaters, das auf Geschichte drängt, tödlich zu Fall kommt. Keineswegs zufällig auf dem extremsten Parkett, das Deutschland zu bieten hat. Getroffen von der Wucht eines ästhetischen Bösen, das – ganz anders als beispielsweise der Satanismus Baudelaires – ein untrennbares Gewebe mit dem deutschen Totalitarismus darstellt. Die politische Wirkungsmacht des wagnerschen Gesamtkunstwerks veranlasst Bertolt Brecht vom Dritten Reich als „Bayreuther Republik“ zu sprechen, während sein Erzfeind Adolf Hitler nach dem Besuch der Wagner Oper „Rienzi“, über den Volkstribun Cola di Rienzo, erstmals vom Phantasma des Nationalsozialismus ergriffen wird. „In jener Stunde begann es!“, klärt der Führer später seinen Jugendfreund August Kubizek über die Geburt der Bewegung auf. Diese heillose Verflechtung von Politik und Ästhetik gehört zu den am wenigsten ausgeloteten und vermessenen Zonen der Kunst und Kultur überhaupt. Geradezu lachhaft, wenn vor diesem Hintergrund vor kurzem die Düsseldorfer Oper eine Inszenierung von Burkhard C. Kosminski aus dem Repertoire kippt, weil sie auf diese Zusammenhänge hinweist.
Der Prozess künstlerischer Aneignung des wagnerschen Erbes, des Gesamtkunstwerks verläuft offenbar nicht ohne Identifizierung; nicht ohne Kontakt mit jenen Energien, die bei der Konstitution des Nationalen in Deutschland eine verheerende Rolle gespielt haben. Der von Wagner evozierte Einbruch des Mythos in die geschichtliche Wirklichkeit bildet einen Unruheherd, der sich nur schwer durch Rationalisierung bändigen lässt, sei es als Ablenkungsmanöver von sozialen Kämpfe um mehr Gerechtigkeit oder durch Rückführung auf ökonomische Determinanten im Zeitalter der Industrialisierung. Ungelebte Überschüsse aus der Traumzeit spielen in das Reale hinein und nehmen monströse Gestalt an. Auf der Ebene der Faszinationsgeschichte sind der Mythos und die mit ihm verwachsenen Phantasmen, die sich in der Tragödie bzw. dem Gesamtkunstwerk fokussieren, keine Hirngespinste, sondern bilden eine sakrale Macht. Philippe Lacoue-Labarthe spricht in diesem Zusammenhang von „einer im Grunde religiösen Kunst“. Ihm zufolge stellt die deutsche Affinität gegenüber der Tragödie und damit gegenüber dem Mythos die entscheidenden Weichen für den geschichtlichen Zug, der in das Dritte Reich mündet und Ausdruck einer „geschichtlich-geistigen Schizophrenie“ ist, die den Geist Hölderlins wie Nietzsches verwüstete und die imstande war „die undenkbare Massenvernichtung auszulösen“. Der französische Philosoph spricht sogar vom „Nationalästhetizismus“. Ein Begriff, der mehr oder minder unterstellt, dass vom Wagnerschen Gesamtkunstwerk, der deutschen Gestalt der Tragödie – „eine Art politischer Kult“ – Energien, Strahlungen in das geschichtliche Feld hineinwirken, welche die geschichtliche Realität der Moderne in irreversibler Weise beeinflusst haben und weiterhin beeinflussen. In diesem Sinne bezeugt Schlingensiefs Interpretation seiner Krankheit, das jenes „Jahrhundert, aus dem wir nicht aufgehört haben hervorzugehen“ (Lacoue-Labarthe) ebenso virulent ist, wie die damit assoziierte Ästhetik. „Ist Wagner überhaupt ein Mensch? Ist er nicht eher eine Krankheit? Er macht Alles krank, woran er rührt, – er hat die Musik krank gemacht – “ diagnostiziert Friedrich Nietzsche lange bevor aus dieser kontaminierten Kunst, aus diesem Geschwulst, die nationalsozialistischen Phantasma hervorbrachen.
Zum Verhängnis wird Schlingensief seine künstlerische Sensibilität, die gegenüber diesen geschichtlichen Verschlingungen keineswegs taub ist, sondern sich den Reißkräften, die im Strom des Nationalen wüten, ungewappnet aussetzt. „Ich habe dem Krebs eine Tür geöffnet. Ich habe dieses Weltabschiedswerk in Bayreuth näher an mich herangelassen, als es mir zuträglich war. Ich hatte auch keinen Schutzpanzer, keine eingeübte Professionalität, im Umgang mit der Oper, ich hatte sozusagen ungeschützten Verkehr mit diesem Werk.” (FR, 13. August 2008). Oder: „Das ist Giftzeugs, was der Wagner da verspritzt hat. Das ist Teufelsmusik, die einen wirklich zerreißt.“
Nimmt man Schlingensiefs Deutung seiner Krankheit ernst, erweist sich, dass das Feld der Geschichte, gerade als ästhetische Gestalt und Konsequenz, eben nicht tot, sondern auf unheimliche Art lebendig ist. Mit Jacques Derrida haben wir es hier mit dem Gespenst der Geschichte zu tun. Die Untoten hausen – um im Bild zu bleiben – auf der Außenhaut einer sich ins Unendliche erstreckenden Blase aus Gegenwart. Während im Innern der Blase Opern abgesetzt werden, die die Verbindung zwischen Wagner und dem Nationalsozialismus veranschaulichen, weist ihr Äußeres tödlich kontaminierte Stellen auf. Insofern markiert der Name Wagner einen ästhetischen Knoten des 19. Jahrhunderts, wo sich emanzipatorisch revolutionäre Traditionen, germanisch oder mittelalterlich Mythisches, Erlösungshoffnungen zu einem bösartigen Gewebe verschlingen, wie sie allein aus der deutschen Geschichte bzw. den speziellen ästhetischen Prämissen, die sich, aus der zerrissenen politischen Situation Deutschlands ergeben, zu verstehen ist. Seine Wirkung in die Zeit ist immens. Selbst Brecht, der Antipode, der im Gegenentwurf jenes anti- mimetische und antitragische Theater zu Weltruhm führte, auf dem die heutige Generation performativer (Zauber-)Künstler fußt, die in Sachen „Research“ unterwegs sind, findet hier die Bedingung seiner Existenz. In dieser vieldeutigen, von Dunkelheit durchsetzten Struktur des Imaginären, wo eine „schizophrene Logik“ (Lacoue-Labarthe) amtiert, spielt sich nach wie vor unser artistisches Leben ab. Die Vertikale zeigt, dass auch das vom geschichtlichen Ballast befreite Theater der Präsenz eine Biographie besitzt und auf ungebändigten geschichtlichen Kräften sockelt, deren Rumoren die Existenz von nicht abgegoltenem und Unerlöstem anzeigen. Schlingensiefs Sensibilität, als Seismograph verstanden, registriert anhaltende Verwerfungen im geschichtlichen Raum und wehrt sich zugleich dagegen Kunst rein als Kunst, also unabhängig von ihrem Gehalt und ihrer Einbettung in die Welt zu betrachten. Trotz ihres Scheincharakters darf die Kunst keineswegs als gleichgültig und unverbindlich missverstanden werden. Wer der Spur, die Schlingensief in der Zeit hinterlässt, treu bleiben will, kommt nicht umhin, sich damit zu beschäftigen, wie jener Knoten zu schürzen ist, den Wagner fatalerweise geschlungen hat. Gelänge dies, wird womöglich freigesetzt, was an Vergangenheit verschüttet, den Weg in die Zukunft versperrt.
Frank Raddatz ist leitender Redakteur bei Theater der Zeit.