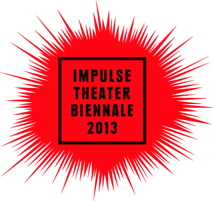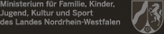curare
13 Dezember 2012
STEFANIE WENNER über kuratorisches Erzählen als Stiftung kultureller Identität
Curare ist ein pflanzliches Gift, das von südamerikanischen Indianern zur Jagd eingesetzt wurde. Es lähmt das Muskelsystem des von einem in Curare getauchten Pfeils getroffenen Tiers und führt zuletzt zu Atemstillstand. Claude Lévi-Strauss beschrieb ausführlich die Wirkung des Giftes und die von ihm vor Ort beobachteten Praktiken der Jagd. Cura rei familialis ist der lateinische Haushalt, curare latein für sich kümmern, sorgen, pflegen.
Kuratoren sind keine Zeitgenossen. In der alten Sprachregelung der Museen galten Kuratoren als diejenigen, die das kulturelle Erbe zu pflegen hatten. Sie entschieden, was in den Kanon von Kultur überführt werden sollte und sammelten symbolisches Kapital zur Stärkung der (nationalen) Identitäten. Die Diskurse von Erbschaft und Vererbung hängen eng mit diesen kulturellen Institutionen zusammen, die juristisch und nicht zuletzt biologisch gedacht sind. Kunst wird hergestellt, nicht immer aber als Kunst. Künstler erzeugen Kunst, sind kreativ oder schöpferisch tätig, nicht immer gehört ihnen ihr Produkt. Zugänglich gemacht wird Kunst den Zeitgenossen von Institutionen, nicht notwendig denen der Kunst, gegen Eintritt. Die Herstellung eines kulturellen Kanons ist legitim. Wer als Kurator eingesetzt wird, wurde in der Regel durch die Institutionen, deren Tradition er oder sie dann bildet, informiert. So garantiert man den Fortbestand von Tradition, erzeugt ein Narrativ, das beständig bleibt. Ausstellungen erzählen – in ethnologischen ebenso wie in historischen oder allen möglichen peripheren Museen – eine Geschichte, stellen Geschichte her als ein Vergangenes, das Identität stiftet: im Heimatmuseum, in Nationalgalerien, in Museen privater Stifter. Choreographen gehen mit Schrift um, Theater mit Geschichten, wir alle mit Narrativen. Boris Groys beschreibt den Umschwung von Kunst herstellenden Kuratoren – die durch die Einordnung von kultischen Gegenständen so genannter primitiver Kulturen in europäischen Museen Kunst schufen, hin zu Künstlern, die durch die Ausstellung im Museum profane Gegenstände zu Kunst machten. „Damit ändert sich die Funktion des Ausstellens in der Gesamtökonomie der Kultur. Früher hat man Kunst durch Abwertung heiliger Dinge produziert – heute dagegen durch Aufwertung profaner Dinge.“ (Groys, Boris. „Der Kurator als Ikonoklast“. In: Die Kunst des Denkens. Hamburg 2008, S. 87 – 106, dort S. 89.) Man muss gegen die Wissenschaften des Lebens sein, denn die produzieren Mehrwert, stabilisieren Vorstellungen von Verwandtschaft und garantieren das Erbe. Fluktuation ist gut, Begriffe sind vielleicht bewegliche Körper. Der Umgang mit vorgefundenem Material ist etwas anders als die Herstellung eines neuen Narrativs.
Vor ziemlich genau vierzig Jahren gründete Harald Szeemann die „Agentur für geistige Gastarbeit“ die er als Gegenentwurf und Antwort auf die Praxis des Kurators als Pfleger des kulturellen Erbes in Institutionen verstand. Er behauptete, auf dem Feld der Bildenden Kunst einzuführen, was auf dem Theater längst gängige Praxis sei: Intendanten luden Gastregisseure ein und gingen auf Gastspielreise mit eigenen Arbeiten. Unterwegs sein als Gegenwehr gegen die Herstellung eines verbindlichen Kanons. Damit bliebe die Institution des Theaters trotz ihrer Maschinerie beweglicher als das Museum, sagt Szeemann. Ketzerisch könnte man behaupten, dass auch das Repertoire eines Wanderzirkus, wie es das Regietheater zur Zeit Szeemans vielleicht bereits gewesen ist, einen Kanon tradiert. Der Transfer dieses Systems aber auf den Bereich der Bildenden Kunst sollte dazu dienen, die Verhältnisse beweglicher werden zu lassen. In der Bildenden Kunst hat der Kurator seither in thematischen Ausstellungen eher die Funktion eines Ikonoklasten eingenommen, denn er lässt die Bilder nicht für sich sprechen. Die Reihenfolge, die für den Ausstellungsbesucher durch den Kurator eingerichtet wird, erzählt eine Geschichte, die über das einzelne Bild, oder die einzelne Arbeit hinausgeht. Damit haben Kuratoren im Kontext der Bildenden Kunst so etwas wie Künstlerstatus bekommen. Man könnte auch sagen, sie sind Geschichtenerzähler und erzeugen ein Narrativ und sind nach dem Tod des Autors die Protagonisten eines Geniestreichs, der aus Kurieren, aus Pflegern − also aus den Gehilfen Kafkas oder Walsers − Popstars macht, die wie die Biologie Mehrwert erzeugen, der anstelle nationaler Ökonomien den Bestand nationaler Identität zu tradieren vermag.
Auf diese Praxis der Schaffung kulturellen Mehrwerts bezieht sich der in Benin geborene und in Amsterdam lebende Meschac Gaba. Er arbeitet seit einigen Jahren als Künstler an seinem „Museum of Contemporary African Art“. Teil dieses Museums sind Geldscheine, auf denen er sein eigenes Portrait abbildete. Alle Kuratorinnen und Kuratoren, die Räume aus dem Museum gezeigt haben, wurden außerdem auf postergroßen Banknoten ihrer jeweiligen Landeswährung verewigt. Geld spielt im Werk Gabas − so jedenfalls das Museum Fridericianum in Kassel, das eine größere Ausstellung des „Museums of Contemporary African Art“ zeigte − die Rolle des Interkulturellen, eine Metapher für Austausch. Kuratoren werden in seinem Werk zu Heroen des Tauschs, zu Idolen, die dem Geld, das universelles Äquivalent ist, ikonische Kraft verleihen.
Der Anthropologe Arjun Appadurai spricht in seinem Buch Geographie des Zorns von vertebralen und zellularen Systemen. Vertebral sind die alten Nationalstaaten, die wie Dinosaurier versuchen, ihr Überleben in Zeiten des globalisierten Kapitals, das zellular organisiert sei, zu verteidigen. Kunst und Kultur erhalten in diesem Zusammenhang die Aufgabe einer Schutzbehauptung: „Da die Behauptung der ‚Volkswirtschaft’, die zu Zeiten starker sozialistischer Staaten und Planwirtschaften noch eine gewisse Plausibilität besaß, fast vollständig zerstoben ist, bleibt heute eigentlich nur noch das Feld der Kultur übrig, um Phantasien der Reinheit, der Authentizität, der Grenzen und der Sicherheit auszuleben.“ (Appadurai, Arjun. Geographie des Zorns. Frankfurt a. M. 2009, S. 37. ) So genannte Passport Shows mehren sich nicht nur in der Bildenden Kunst, auch auf dem Theater werden Showcases, also Schaufenster, für Nationen geboten, die sich so darstellen können. Kuratoren reisen zu diesen Showcases und betreiben Im- und Export. Konzepte wie das der Nation und der Regionalität, die politisch diskutiert und infrage gestellt werden, werden damit im Rahmen von Kultur re-inszeniert und konserviert. Dazu passt die Anekdote, die Slavoj Zizek in seinem Buch zur Krise des Kapitalismus Auf verlorenem Posten von Ethnologen, die auf der Suche nach einem furcht erregenden Totentanz mit Masken aus Schlamm und Holz in den Dschungel gingen, erzählt. Sie hatten gehört, ein tief im Urwald lebender Stamm von Ureinwohnern praktizierte so etwas. Als sie dort eintrafen, erklärten sie mit Händen und Füßen, wonach sie suchten, um am nächsten Tag genau einen solchen Tanz vorgeführt zu bekommen. Sie fühlten sich als Forscher bestätigt und kehrten zufrieden nach Hause zurück. Einige Jahre später jedoch kamen wieder Forscher zu diesem Stamm und fanden heraus, dass der Tanz aus Gastfreundschaft nach den Wünschen der Ethnologen aufgeführt worden war. Es war also kein altes Ritual, das sie zu sehen bekamen, sondern eine hastig improvisierte Aufführung des eigenen Wunsches. „Die Stammesmitglieder hatten irgendwie verstanden, dass die Fremden einen furchterregenden Totentanz sehen wollten. Also bastelten sie, geleitet von ihrem hohen Sinn für Gastfreundschaft und der Hoffnung, ihre Gäste nicht zu enttäuschen die ganze Nacht hindurch an den Masken und studierten einen erfundenen Tanz ein, um die Ethnologen zufriedenzustellen.“ (Zizek, Slavoj. Auf verlorenem Posten. Frankfurt a. M. 2009, S. 14.) Wenn Kuratoren am Theater oder von Festivals sich Themen überlegen, so tun sie das – so tun wir das – sicher in steter Auseinandersetzung mit der künstlerischen Praxis, die wir kennen und hoffentlich in der Anstrengung, einen Raum zu etablieren, in dem diese Praxis sich weiter entfalten kann. Dennoch trägt diese Arbeit Züge des erwähnten ethnologischen Projekts, das mit der Erwartung an bestimmte Inhalte diese letztlich herzustellen half. Kuratoren sind der Wortbedeutung nach, ich erwähnte es bereits, Pfleger. Nach bürgerlichem Recht aber ist ein Kurator ein gerichtlich eingesetzter Aufseher für eine Person, die nicht anwesend ist. Vielleicht auch ist die Aufgabe von Kuratoren denjenigen, die keine Stimme haben, keinen Ort zu sprechen, keinen Raum, sich zu zeigen, darzustellen, einen Ort einzuräumen. Das wäre dann ein legitimes Nachfolgen des bürgerlichen Rechts. Pflege des kulturellen Erbes obliegt den Kuratoren an Museen, die eine Sammlung verwalten oder Ausstellungen einrichten. Ein Kuratorium ist ein beaufsichtigendes Gremium. Die klassische Position des Dramaturgen am Theater wird an vielen Orten durch Kuratoren ersetzt. Was bedeutet das, wenn man den Ansatz Harald Szeemanns versucht aus der Bildenden Kunst auf das Theater zurück zu übertragen? Wenn postdramatisches Theater nicht die Narrative des Bürgerlichen wiederholt, sondern sich – manchmal explizit antinarrativ – mit Formen und Inhalten befasst, haben jetzt thematisch arbeitende Kuratoren am Theater die Rolle übernommen, eine Rahmenhandlung zu erfinden und doch eine Geschichte zu erzählen. Die Position des Kurators am Theater steht damit in der Gefahr, restaurativ eine Identität zu stiften.
Postdramatisches Theater, Performance auf dem Theater, ist aber mit ebenso starker Berechtigung eine Bilderproduktionsmaschine wie Film oder Bildende Kunst. Kuratoren hätten dann vielleicht doch, wie Groys sagt, die Aufgabe des Ikonoklasten auszuüben. Nicht im Sinne eines permanenten Zweifelns und Infragestellens der Bildlichkeit des Bildes oder der Theatralität von Theater oder der Performativität von Performance, sondern im Sinne einer performativen Setzung und Auseinandersetzung mit der Künstlichkeit des Theaters, das für Performancekunst vielleicht ein ebenso guter oder schlechter Raum ist wie der White Cube für die Kunst. Vielleicht. Vielleicht geht es aber gerade darum, jenseits der klassischen Erzählstrukturen so etwas wie Subjektivität zu behaupten, so etwas, wie die Möglichkeit, trotz allem Einspruch zu erheben und Verantwortung zu übernehmen gegen ein übermächtig und komplex erscheinendes System, gegen Determinismus, auch den von Kulturpessimsiten. Kuratoren als Zeitreisende zwischen post und prä, zwischen Zukunft und Vergangenheit, die Gegenwart kurierend, also doch Avantgarde. Das System zum Stillstehen bringen, für einen Augenblick wahrnehmbar machen. Einen Pfeil abschießen, wie in Curare getaucht. Wenn die Aufgabe der Philosophie ist, ihre Zeit auf den Begriff zu bringen, wie noch Hegel sagte, vielleicht könnte es Aufgabe des Theaters sein, und damit Verantwortung auch von Kuratoren, Entschleunigung auf die Bühne zu bringen und damit unsere Zeit, Facetten unserer Gegenwart, wahrnehmbar zu machen. Gift sein gegen Verdinglichung durch Materialismen unterschiedlicher Herkunft. Nicht einfach den Kanon aus der Vergangenheit bilden, Erzeugen einer neuen Tradition. Das Theater für die Herstellung eines Diskursraums nutzen, der kein Narrativ im klassischen Sinne etabliert, sondern einen Resonanzraum öffnet und eine Reflektion von Gegenwart lanciert. Damit kommen Kuratoren zwangsläufig in Konkurrenz mit Künstlern, die ebendies immer schon für sich behauptet haben. Oder trifft sogar der von Kuratoren abgeschossene Pfeil nicht das System, sondern lähmt die künstlerische Praxis, wie mein Freund, der ungenannt an diesem Text mit geschrieben, ihn auf jeden Fall gesprächsseitig informiert hat, meint? Zeitgenossenschaft ist dann eher ein Problem als ein Vorteil und Kuratoren sollten mit Schwesternhäubchen ausstaffiert ihren Platz einnehmen in den Pflegeberufen des Kulturbetriebs, der das revolutionäre Potential von Kunst vielleicht gerade auf dem Theater fürchtet und sich doch nur die alten Geschichten erzählen will. Das lähmende Gift von Curare verfehlte dann seine Wirkung. Und so behaupte ich dann doch lieber die Erzeugung von Resonanz und die Etablierung von Räumen des Austauschs, die keine lähmende Wirkung, sondern im günstigen Fall beflügelnde Kraft haben mag. Wuchernde Zellen generieren, keine bösen Zellen, Felder, von denen vielleicht Wirkung ausgeht und die – bescheiden – eine Reflektion des Status quo versuchen.
Der Text erschien zuerst in tanzheft 2, November 2009