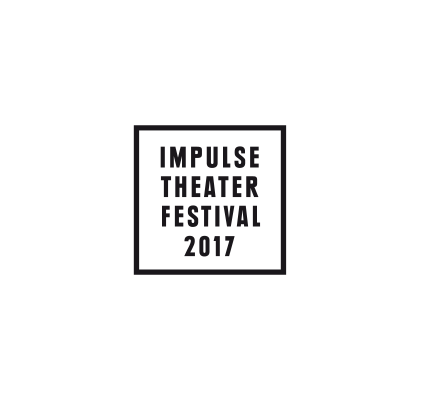Eröffnung 2017: Florian Malzacher über Politik, Theater & Selbstzensur
22 Juni 2017
Sehr geehrte Damen und Herren –
liebe Freunde –
über vier Ausgaben und fünf Jahre hinweg hat das Impulse Theater Festival die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Politik gestellt und danach, was politisches Theater heute sein kann. Die künstlerischen Antworten darauf waren und sind vielfältig, oft auch widersprüchlich, Suchbewegungen eher als Manifeste – und doch zugleich künstlerisch klare Positionierungen.
In dieser Zeit hat sich die Welt weiter verändert, man kann sagen, von den politischen Konflikten und Problemen, die vor fünf Jahren sichtbar waren, sind nicht gerade viele verschwunden. Und die Kunst ist zunehmend wieder zu einem Ort geworden, der sich als öffentlicher Raum begreift, ihn definiert und zugleich zur Verfügung stellt. Für uns war dabei die Idee des „agonistischen Pluralismus“ der Politikphilosophin Chantal Mouffe, die in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal unser Gast sein wird, sehr produktiv.
Während viele Philosophen – von Karl Marx bis Jürgen Habermas – an die Möglichkeit eines allgemeinen gesellschaftlichen Konsens glauben, warnt Mouffe davor, durch vermeintlichen Konsens unterschiedliche Meinungen nur zu unterdrücken, was am Ende zu feindlichem Antagonismus führe: Wenn wir wollen, „dass die Menschen frei sind, müssen wir immer die Möglichkeit erlauben, dass Konflikt auftaucht und eine Arena zur Verfügung stellen, wo Differenzen konfrontiert werden können.“
Für mich liegt hier das besondere Potential von Theater: In einer Zeit, wo einerseits das Diktum „Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns“ eine erstaunliche Renaissance hat, andererseits eine Logik des Konsens alle demokratische Diskussion einschläfert, Arenen zu sein, in denen wir unsere Differenzen als Gegenspieler ausagieren können ohne sie befrieden zu müssen. Es ist ja kein Zufall, dass Agonismus – also das demokratische ausagieren gegnerischer Positionen ohne in absolute Feindschaft zu verfallen – seinen Namen vom Theater entliehen hat, von agon, dem Wettstreit der Argumente in der griechischen Tragödie.
In diesen letzten fünf Jahren ist aber auch die Diskussion darum, was Kunst sein darf und soll, lauter geworden. Das Sich-Einmischen, Teil der Gesellschaft sein wollen, wird mit teils verdächtiger Vehemenz bekämpft, auch in der Kunst selbst. Es gibt plötzlich und eher überraschen wieder einen Ruf nach Autonomie der Kunst, nach einer Kunst, die ihren Wert ausschließlich in sich selbst findet. Kunst, die sich hingegen unmittelbar politischen und sozialen Fragen widmet, wird vorgeworfen, sich instrumentalisieren zu lassen und sich vor allem Förderlogiken zu unterwerfen. Also: Keine richtige Kunst zu sein.
Diese Vorwürfe werden manchmal so laut, dass man den Verdacht bekommt, sie dienten eher dem Übertönen der eigenen Unsicherheit, ob ein ästhetisches Weiter-so in einer Welt, die sich rasant und offenkundig nicht nur zum Positiven verändert, nicht vielleicht doch der falsche Weg sei.
So sehr ich natürlich der Meinung bin, dass Kunst unabhängig sein muss, so sehr glaube ich, dass Unabhängigkeit nicht bedeuten kann, sein Umfeld zu ignorieren und sich als diffuses Außen zu imaginieren. Und ich bin überzeugt, dass die Künstler, die in den nächsten zehn Tagen zu sehen sind, nicht gerade den Eindruck erwecken, sonderlich fremdgesteuert zu sein.
Und was Förderstrukturen angeht: Auch wenn ich Einmischung in künstlerische Prozesse durch die Politik grundlegend ablehne: Mir ist eine Politik, die politische Haltungen in der Kunst fördert, deutlich lieber als eine, die will, dass die Kunst dazu die Klappe hält.
Problematischer ist das Problem möglicher Selbstzensur, das auftaucht, wenn man nur realpolitischen Erwägungen folgt – und das ist komplexer als das der Fremdzensur. Zwischen Selbstbeschränkung und Selbstzensur ist oft nur ein schmaler Grat. Welche Positionen halten wir aus, welche müssen wir aushalten – und wo müssen wir klare Grenzen ziehen und deutlich sagen: Das wollen wir so nicht mehr sehen. Diese Fragen werden zur Zeit drängend und vehement diskutiert – und Antworten sind nicht einfach. Was darf man zeigen, um es kritisieren zu können? Und was sollte man nicht (mehr) zeigen, um alte Ungerechtigkeiten, bestehende Hierarchien zu vermeiden?
Wie man sich als Künstler positioniert, das ist eine Frage der Entscheidung. Und oft eben einer mutigen Entscheidung. Und genau das interessiert uns bei der diesjährigen Festivalausgabe unter dem Titel „Decide or Else!“: Wie wir entscheiden, was wir entscheiden dürfen und wollen – und wer Teil dieses „wir“ ist und wer nicht.
Solche Entscheidungen werden nicht nur in der Politik gefällt oder im Privaten, sondern auch im Theater. Immer wieder mal wird behauptet, dass eine demokratische Kunst nicht möglich oder zumindest meist schlecht sei. Gerade dieses Festival hat immer wieder gezeigt, dass das ganz so wohl nicht stimmen kann: Selbstverständlich gibt es starke künstlerische Positionen, die versuchen, mit Hierarchien anders umzugehen.
Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Kollektive dabei, die bewusst auf eine dominante Regisseursposition verzichten: die jungen Gruppen Swoosh Lieu und Vorschlaghammer, die österreichischen Rabtaldirndln und die vertrauten Impulse-Gäste She She Pop. Es gibt kollaborative Ansätze wie die von Gintersdorfer/Klaßen, Monster Truck oder internil, aber auch im Umgang mit dem Publikum beim Hamburger Fundus-Kindertheater beispielsweise. Und es gibt auch den bewussten Umgang mit der eigenen Rolle als Regisseur, wie bei Milo Rau, oder auch bei Boris Nikitin, dessen Hamlet wir gleich im Anschluss sehen. Dass auch im eigenen Arbeiten darum gerungen wird, in welcher Welt wir leben wollen, schließt gute Kunst jedenfalls definitiv nicht aus. Und für politische Kunst ist es unabdingbar.
Ich freue mich, nun mit Ihnen allen gemeinsam das Festival mit der Vorstellung von Boris Nikitins Hamlet zu eröffnen. Dieser Hamlet macht es uns nicht einfach. Er ist nicht sympathieheischend. Er klagt an: uns, sich selbst, ist dabei oft ungerecht, selbstgerecht – und hat doch meist eben wirklich recht. Dieser Hamlet ist nicht gefällig, er ist mutig, aber nervt auch, er verlangt von uns als Publikum, uns permanent zu positionieren.
Dass ausgerechnet Impulse, das Festival des freien Theaters – und damit vor allem des postdramatischen Theaters – mit einem Hamlet beginnt, also dem großen Nicht-Entscheider der Weltliteratur, passt in diesem Haus – dem Schauspiel Köln – natürlich. Es wird quasi kein Wort der Shakespearschen Vorlage gesprochen – vielleicht ist es aber gerade deshalb eine so zeitgenössische, verstörende Hamletfigur, die Julian Meding hier spielt.
Es gibt diese Anekdote, dass einer der Bachsöhne am Klavier spielte und dann irgendwann aufsprang ohne seine Melodie mit einem Schlussakkord aufzulösen. Stunden später ist der alte Bach dann aufgestanden, zum Klavier gegangen und hat den fehlenden Akkord gespielt – erst dann konnte er schlafen. Mich hat der Hamlet, den wir heute sehen werden, mit so einem Gefühl der Dissonanz, des Nichtaufgelösten, zurückgelassen – und darin ist er dem Shakespeareschen Hamlet sehr ähnlich.
Ich denke, die Künstler und die Macher dieses Festivals eint, dass sie nicht glauben, dass es diesen Schlussakkord, diese Antwort, diese Entscheidung ohne die Bach nicht schlafen konnte, noch geben kann. Diesen Akkord werden wir also auch in den folgenden Arbeiten im Festival nicht setzen.
Und doch hoffe ich sehr, dass Sie alle häufig wiederkommen werden, um gemeinsam mit uns nach ihm zu suchen. Denn das ist vielleicht die Situation, in der sich Kunst (und wir als gesellschaftliche, politische Wesen) befinden: Dass wir nicht mehr glauben können, dass es diesen Schussakkord, diese eine, allgemeingültige Antwort geben kann. Dass wir aber eben auch nicht aufhören dürfen, danach zu suchen, daran zu arbeiten.